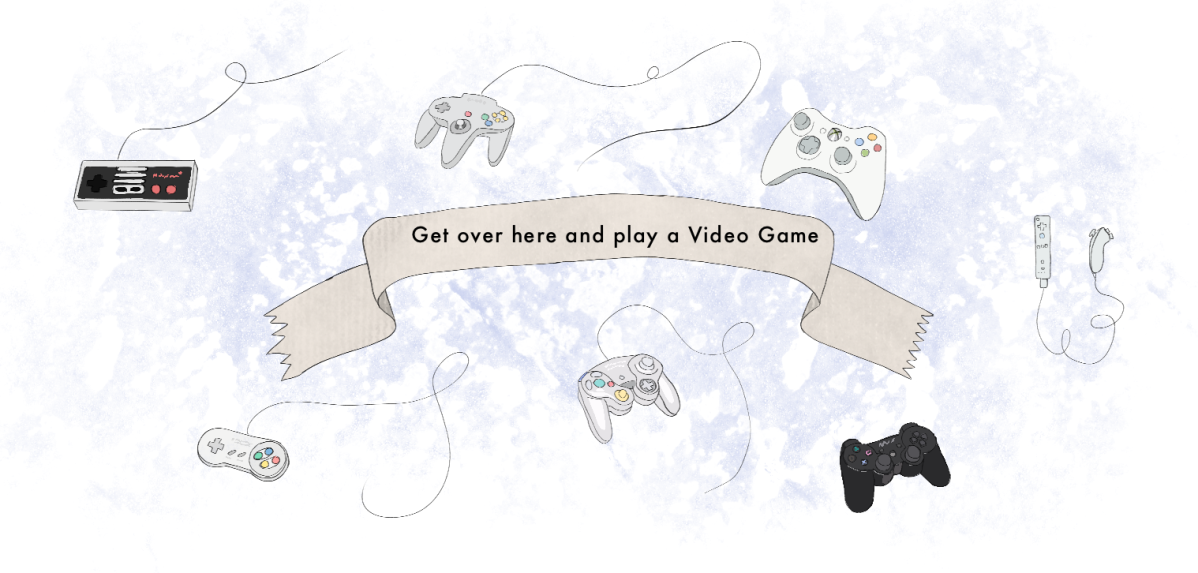(Impulsvortrag anlässlich einer Nacht über Terry Pratchett)
Lyon Sprague de Camp schreibt über Fantasy, es sei die Literaturgattung, die eine Welt beschreibt, die es hätte geben müssen, damit eine gute Story entsteht. Ich schließe mich dem vollständig an. Weiter behauptet er, dass eine gute Story in einer Welt spielt in der alle Männer Helden, alle Frauen schön und alle Probleme einfach waren. Naja.
Fantasy stammt aus der Antike. Wir erinnern uns an Homer, den ersten schriftlichen Fantasy-Autor, dessen Geschichten alle so ablaufen: Männer tun männliche Dinge. Da wäre mal Zeus, der männlichste Mann, erster Fantasy Held und Serienvergewaltiger. Achilles, erster Halbgott, Sklavenhalter, Kriegsverbrecher. Odysseus, der weltreisende Raubmörder. Und die beiden etwas seltsamen Helden Theseus, dessen erstes Opfer der „Keulenträger“ Periphetes wird und dessen größter Triumph darin besteht, den von einer Kuh bewohnten Palastkeller zu durchqueren. Und dann Ödipus, der, naja …
Jedenfalls ist das Monsterkompendium seit der Antike gut gefüllt. Denn die männlichen Helden vermöbeln mit Vorliebe starke Frauen mit tragischen Geschichten. Sphinx, Medusa, Harpyie, die Gorgonen, Kirke und Hera, und manchmal Athene, sind die Endgegner der antiken Männerfantasie.
Fantasy stammt aber auch aus dem Mittelalter.
Thomas Malorys Epos über König Artus und die Ritter der Tafelrunde ist ein Prototyp der erzählenden Phantastik. Es ist in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden und das erklärt auch, warum Artus Ritter anstatt Römerhelmen Langschwerter tragen. Hier jedenfalls betritt der erste Gandalf, Elminster, Dumbledore der Literaturgeschichte die Bühne: Merlin. Kind von Dämonen und auch ansonsten eine zwielichtige Gestalt. Aber immerhin Magier des Königs.
Wobei der echte Merlin von Don Rosa in seinen Dagobert-Heften historisch sicher akkurater dargestellt ist. Ein heruntergekommener Bänkelsänger am Hof eines Dumnonischen Kleinfürsten. Der dann im Verlauf der Zeitreise-Geschichte auch noch das einzige scharfe Schwert (Excalibur: Keltisch Hartscharte) seines Fürstentums an die Ducks verliert.
Um einiges realistischer ist da schon die erste Comicserie der Welt von Harold Foster (geboren 1892) und Max Trell: Prinz Eisenherz. Darin erscheinen alle Komponenten des Ritterromans, aufgepeppt durch historisch relativ akkurate Kostüme, weniger akkurate amerikanische Ureinwohner und Plots, in denen es um das strategisch kluge Überlisten mächtiger Feinde geht. Darunter auch immer wieder die Enttarnung des einen oder anderen falschen Hexenmeisters. Harold Fosters Merlin ist ein Mann der Wissenschaft, der seine Erkenntnisse mit esoterischen Kalendersprüchen aufregender macht, um sie leichter an den Mann zu bringen. Prinz Eisenherz ist sein gelehriger Schüler.
Bis heute ist das beliebteste Fantasy-Setting eine feudale Gesellschaft. Deren Reiz liegt natürlich darin, dass die Protagonisten von Fantasy meistens entweder bereits aus dem Adelsstand stammen oder durch ihren Heldenmut dorthin gelangen. Also entweder reich geboren sind, oder Superkräfte haben, oder beides.
Dass die mittelalterliche Gesellschaft sich für den Heldenmut der Normalbürger nicht allzu sehr interessierte, ist historisch belegt. Oder kann sich von euch noch jemand an den tapferen Mann erinnern, der bei der Schlacht von Hastings 1066 die rechte Flanke von König Harolds Angel-Sachsen zu einem Sturm vom Hügel herunter motiviert, und damit den Normannen die Eroberung Englands und Wilhelm dem Eroberer seinen Titel ermöglicht hat?
Im Mittelalter dient die Literatur der Zuweisung von gesellschaftlichen Plätzen, der Bestätigung von Herrschaft. Erst Aufklärung und Säkularisierung bringen Fantasy in die Form, die wir heute kennen. Moderne Fantasy setzt die Trennung von Phantasie und Herrschaft voraus. Oder anders gesagt: Fantasy ist alles, was wir uns vorstellen können, ohne Zwang und religiösen Wahn, eine kleine Revolution.
Thomas Morus schreibt 1516 über „Utopia“, eine Insel, auf der Menschen mit Hilfe von Robotern und angeleitet von weisen Männern ein gutes Leben frei von feudalen Zwängen führen.
Der Roman „Gargantua und Pantagruel“ des Mönchs Rabelais ist ebenfalls ein früher Zeuge für die widerständige Kraft der Fantasy. Der Riese Gargantua und sein Sohn erleben allerhand wunderliche und definitiv nicht politisch korrekte Abenteuer und finden eines Tages das versteckte Kloster Thelema, auf dessen Tor geschrieben steht: Tu was du willst!
Rabelais macht bereits im 16. Jahrhundert mittels Phantastik Werbung für den Anarchismus. Denn für ihn sind Menschen, die in Freiheit und mit liebevoller Erziehung aufwachsen, von Natur aus dazu fähig miteinander ohne äußeren Zwang respektvoll und friedlich umzugehen.
Phantastik ist ein Erzählgenre das sich im Roman des 18. Jahrhunderts endgültig herausbildet. Gute Fantasy beinhaltet viel Phantasie, viele Wunder und wunderbare Wesen. Aber Phantastik braucht nicht unbedingt Phantasie, denn die Motive und Kreaturen, an denen sie sich abarbeitet, existieren seit Jahrtausenden. In schlechter Fantasy wird nur das wiedergekäut, was wir eh schon alle zur Genüge kennen.
Ich sage jetzt nicht Harry Potter, aber bei Harry Potter ist das so. Alles ist ein wiederaufgewärmter Strudel von vorgestern, der happengerecht zum Konsum präsentiert wird.
Etwa das Waisen- oder Findelkind Motiv: Ein Kind wird von seiner Geburt an zu einer Machtstellung in der Welt bestimmt. Der Antagonist bemüht sich erfolglos durch eine Reihe von Anschlägen die Entscheidung des Schicksals zu vereiteln. Das Schicksalskind gelangt zu seiner Bestimmung: sein Feind wird besiegt. Die ersten überlieferten Schicksalskinder sind Buddha und König Artus. Aber auch Elora Danan gehört zu ihnen.
Fantasy kann auch Ablenkung sein. Und Wirklichkeitsflucht ist den Herrschenden oft recht. Schlechte Fantasy ist genau das: ein Herrschaftsmittel. Die Aufklärung will das Licht der Vernunft dazu verwenden alle Schatten von der Erde zu verbannen. Alles soll eindeutig und klar werden. Für Kant ist jede Fantasy schlechte Fantasy. Aber von der Revolution hält er nach dem Erhalt seiner Professur auch nichts mehr.
Es stimmt: Mit dem richtigen Licht lässt sich gut sehen. Aber mit Wissenschaft alleine lässt sich keine Revolution machen. Die Romantiker erwidern: Wenn das Licht so auf eine Stelle konzentriert wird, dass die Schatten ganz verschwinden, bleibt alles rundherum im Dunkeln.
Vielleicht liegt das daran, dass Revolution und Phantasie doch etwas gemeinsam haben. Die Phantasie ist eine produktive Kraft. Wer sich vorstellen kann, dass es anders sein kann, der hat zumindest eine Ahnung davon, dass man das, was ist, ändern kann.
Die Romantiker erweitern die Phantastik in die Religion hinein, sie verwenden sie wie ein trojanisches Pferd . Friedrich Schleiermacher schreibt 1797, also kurz vor der französischen Revolution: „Ihr werdet es wissen daß Eure Phantasie es ist, welche für Euch die Welt erschafft, und daß Ihr keinen Gott haben könnt ohne Welt.“ (ÜdR: 72)
Die deutsche Romantik verwendet das Übernatürliche und Wunderbare als Ausdrucksmittel menschlicher Gefühle. Aber auch als Waffe gegen religiöse Fundamentalisten und staatliche Repression.
Die Phantastik dient dazu Phantasie in den Mainstream einzuschmuggeln. Das Phantastische bereitet den Weg für Science Fiction und Superhelden Comics. Es wird zum Mittel das randständige und seltsame, die Außenseiter, ins Zentrum zu rücken. Dass der Batman heute ein „Dark Knight“ ist, verdankt er der Romantisierung des mittelalterlichen Ritters. Dass er ursprünglich in Detective Comics auftrat, verdankt er Arthur Conan Doyle und seinem Sherlock Holmes.
Wir verdanken große Teile der Fantasy des 20. Jahrhunderts den Romantikern. Die Welt des Herrn der Ringe ist genau das: Eine romantische Gesamtschau der frühenglischen Ritternovelle, in Form eines epischen Reiseführers mit Sehenswürdigkeiten und Top-Wanderrouten.
Aber die Fantasy-Welten des 21. Jahrhunderts stammen aus der Feder unzähliger AutorInnen. Anne Rice (Vampire), Fritz Leiber (Schwerter von Lankhmar) und Michael Moorcock (Elric von Melniboné der Albino Elf) in den 1970ern, R. A. Salvatore ab 1988 „The Legend of Drizzt“ (der Dunkelelf). Aus ihren Ideen hat aber nicht nur Joanne K. Rowling ihre Ideen geklaut, sondern auch Andrzej Sapkowski mit seinem Geralt von Riva.
Alle zusammen stehen sie in der Schuld bei einem Bodybuilder namens Robert E. Howard, einem Zeitgenossen und Freund von Harry Hudini und H. P. Lovecraft.
Howard hat das Heldenepos ins 20. Jahrhundert geholt und mit Conan einen Helden erschaffen, der mit seiner pragmatischen Einstellung zu Abenteuern bis heute ein Vorbild für sämtliche Fantasy-Rollenspieler abgibt. Er ist ein Dieb, ein Frauenheld, ein Superspion und ein Schwertmeister, alles in einem. Und wenn er ein Kamel K.O. schlägt, dann hat er seine guten Gründe dafür.
Aber bereits bei Ludwig Tiecks Erzählung „Die Elfen“ von 1811 gibt es eine Vorschau auf Tolkiens Galadriel: Eine große Frau in glänzendem Kleid, warm lächelnd und voller tödlicher Macht. Tiecks Geschichte endet mit dem Tod.
Wir erinnern uns an den Film: „Anstelle eines dunklen Herrschers hättest du eine Königin; nicht dunkel, aber schön und entsetzlich wie der Morgen, tückisch wie die See, stärker als die Grundfesten der Erde. Alle werden mich lieben und verzweifeln!“
Bevor wir jetzt alle anfangen zu weinen: Es gibt auch Funny Fantasy. Also Fantasy, die sich über Fantasy lustig macht. Als würde sie das nicht eh von selbst erledigen.
Der Herr der Ringe ist nicht funny. Und an manchen Stellen fast lachhaft, wie ernst die Protagonisten ihre Ringe und Steine nehmen. Aber eigentlich gibt’s da nichts zu lachen. Und wenn die Protagonisten mal lachen, dann nur weil sie sich nach überstandenen Gefahren lebendig wiedersehen. Tolkien beschreibt, aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrend, eine Welt im Untergang. Und fragt man Winston Churchill, dann hat er damit recht. Großbritannien verliert im Ersten Weltkrieg sein Empire.
Aber niemals den Humor. Oder, um den Bauern Dennis aus „Die Ritter der Kokosnuss“ zu zitieren: „You can’t expect to wield supreme executive power just ‚cause some watery tart threw a sword at you!“ Das sagt er zu König Artur.
Puh!! Empire verloren, aber Humor gerettet. Einige Ritter gibt es also doch noch. Einer davon ist Terry Pratchett, bei dem schon die Ansammlung an Konsonanten in Vor- und Nachnamen einfach zum Spaßhaben anleiten. Diese Namen kann man kaum falsch schreiben. Jedenfalls war Pratchett vor seiner Karriere als Autor im Industriemanagement (Atomkraft) tätig. Und auch das merkt man seinen Büchern an. Er hatte übrigens ein „ausgeprägtes Interesse“ an Orang-Utans und wird von seinen Fans Pterry genannt. (Stummes P von Ptolemaios.)
Terry Pratchett ist das Aushängeschild der Funny Fantasy, ein absoluter Bestseller, dessen Bücher sich, wie Wikipedia sagt „durch die zum Teil überbordende Verwendung von Fußnoten auszeichnen“. Na, wenn etwas Phantasie und Humor in einem zum Ausdruck bringt, dann sind es Fußnoten!