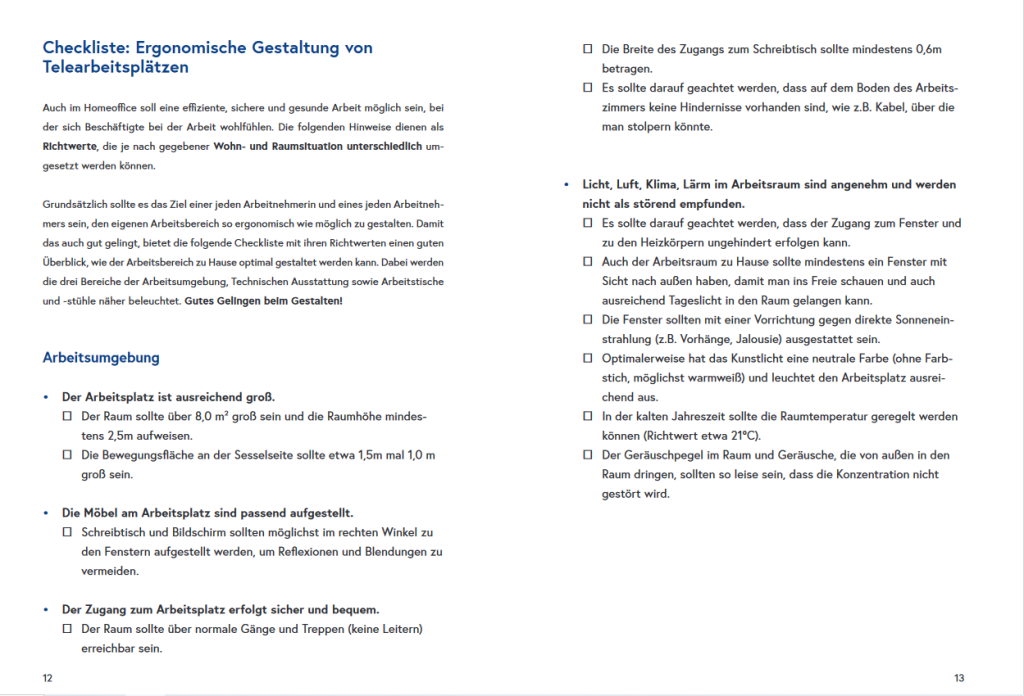Der von uns hochgeschätzte Verbrecher Verlag bringt jedes Jahr ein Spektrum interessanter und lesenswerter Bücher heraus und macht mit der darin aufgefundenen Bandbreite an kritischer Literatur immer wieder Lust darauf mehr aus dem Sortiment zu lesen. Wir haben uns für einen Titel entschieden, der, nach unserer intensiven Beschäftigung mit dem Thema der gesellschaftlichen Gewalt gegen Frauen, hier nachzulesen, klang wie die ins Buch gebrachte Synopsis unserer Arbeit. Spoiler: Es geht um Femizide.
Der Begriff des Femizids
„Femi[ni]zide. Kollektiv patriarchale Gewalt bekämpfen“ ist das Werk eines „Autor*innenkollektivs“, das sich BIWI KEFEMPOM nennt. Diese Abkürzung bedeutet „Bis wir keinen einzigen Femi(ni)zid mehr politisieren müssen“. Die Autorinnen, die sich im Buch dann trotz kollektiven Umschlagsnamens, namentlich und mit Biographie vorstellen, befassen sich intensiv mit dem Begriff des Femi(ni)zids und zeichnen die Entstehung einer Bewegung nach, die sich gegen die durch ihn zum Ausdruck gebrachte Gewalt gegen Frauen in Stellung bringt. Dabei werden besonders die politischen Strategien zur Politisierung von Femi(ni)ziden ins Auge gefasst und die politische Praxis der Protestformen, die darin zur Anwendung kommen, dargestellt. An diesen Stellen glänzt das Buch durch detailreiche zeithistorische Abbildung und die genaue Erfassung politischer Zusammenhänge, die zugleich als Inspirationsquelle für neue Bewegungen verstanden werden können. Hier entsteht die Möglichkeit aus einem Text heraus eine Praxis zu imaginieren, in der politische Organisation und Widerstand möglich sind. Es geht um die Anleitung zu feministischen Raumnahmen die zur Begegnung, Vernetzung und Politisierung genutzt werden können, die die Trennung von privat und öffentlich durchkreuzen und Vereinzelung und Ohnmacht entgegenwirken können. (vgl. 127f.) Der Kampf gegen die patriarchalischen Gewaltstrukturen soll bewusst zwischen aktiver Verteidigung „Frauenpatrouille“ und künstlerischer Aneignung „Straßentheater“ stattfinden. (vgl. 136) Zur Erforschung der Grundlagen der herrschenden Gewaltverhältnisse sollen feministische Genealogien entwickelt werden, die die historischen Verläufe der Gewaltentwicklung explizit machen und die Erarbeitung einer feministischen Geschichtsschreibung ermöglichen. (vgl. 23f) Diese soll eine Identifizierung und Infragestellung von rechtfertigenden Narrativen misogyner Gewalt durch patriarchale Institutionen ermöglichen. (vgl. 27)
Wir sind mit dem Ziel dieses Buches solidarisch. Besonders die letzten Sätze im vorigen Absatz könnten das Motto unseres momentanen Projekts einer feministischen Geschichte Österreichs sein. Die Aufklärung über patriarchale Gewaltverhältnisse und die Erarbeitung von Begriffen zu ihrer Kritik steht auch im Zentrum unserer publizistischen Tätigkeit. Darüber hinaus sehen wir auch den Sinn einer interventionistischen Textproduktion, die einen Anspruch über das Erteilen von guten Ratschlägen hinaus erhebt. Brauchbare Interventionen wecken Gefühle, indem sie den Gewaltverhältnissen durch die explizite Darstellung der konkreten Gewalt die Maske herunterreißen. Die Sprache der Verhältnisse ist die Sprache der Gewalt. An diesem Faktum kommt kein interventionistischer Text vorbei. Es ist daher nahezu unmöglich einen interventionistischen Text zu verfassen, der gleichzeitig nach akademischen Maßgaben und mit Rücksicht auf individuelle Befindlichkeiten operiert. An dieser Stelle beginnen unsere Probleme mit diesem Text.
Gesellschaftliche Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit Femiziden
Für die Autorinnen soll es konsequenterweise „kein akademisches Privileg, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit“ (21) sein, sich mit Femi(ni)ziden auseinanderzusetzen. Gleichzeitig geht es in dem Buch merkbar von Anfang an nicht in erster Linie um patriarchale Gewalt gegen Frauen, sondern um ein allgemeines und in seiner Beschreibung oft diffuses Gewaltproblem gegen, durch akademisches Vokabular erfasste, Opfergruppen. Zusammengefasst unter dem sperrigen Begriff FLINTA erweitert sich der Bedrohungshorizont von „Frauen“ etwa auch auf „Lesben“. Und es stellt sich zum ersten und nicht zum letzten Mal in diesem Buch die Frage, ob das ganz ernst gemeint sein kann? Sind Lesben keine Frauen? Aber gleich danach wird klar, worum es wirklich geht. Und zwar um die akademischen Privilegien von „inter, nicht-binären, trans oder agender Personen“ (ebda.).
Der, im ersten Halbsatz des ersten Kapitels dankenswerterweise kritisierte akademische Jargon wird im zweiten Halbsatz zur Hilfe genommen, um die Position der Frauen in dem Buch über Gewalt gegen Frauen zu relativieren. Denn nun geht es nicht mehr um das Faktum, dass Frauen unter männlicher Gewalt zu leiden haben, sondern um „die traurige Tatsache, dass FLINTAs tagtäglich ermordet werden“. Es geht also um ein ganzes Spektrum an von Gewalt betroffenen Gruppen, von denen einige auch männlich gelesen werden können und es geht auch nicht mehr eindeutig um männliche Gewaltstrukturen und das Patriarchat, sondern um „die strukturellen und kontextspezifischen Bedingungen, die Femi(ni)zide ermöglichen“. Und wir dachten das zumindest wäre schon geklärt. Aber die akademischen Peergroups fordern ihre Opfer an Klarheit und deshalb wird selbst dieser akademisch verklausulierte Minimalkompromiss noch einmal aufgeweicht zugunsten der Relativierung im dritten Satz, dass es um „feminisierte und/oder rassifizierte Menschen“ gehen soll. Drei Sätze, die das Programm des Buches gut beschreiben. Wo es im Titel um den Kampf gegen patriarchale Gewalt geht, geht es ab dem Einbezug des Begriffs FLINTA, der bewusst „kein abgeschlossener Begriff“ (13) ist, nicht mehr um Feminismus, sondern um ein allgemeines Kritikprojekt mit „dekolonialer“ Perspektive, in der also auch die Rechte von Männern und die Opfer von Rassismus eine wichtige Rolle spielen.
Feminismus vs. Antirassismus?
Die Ungerechtigkeit des europäischen Asylrechtsregimes ist evident. Wir haben uns an anderer Stelle damit befasst. Feminismus und Antirassismus gehen für uns selbstverständlich Hand in Hand, weil wir ALLE Verhältnisse umgeworfen wissen wollen, in denen Menschen erniedrigte und geknechtete Wesen sind. Also nicht nur die Verhältnisse, die unserem persönlichen akademischen Racket unangenehm sind, sondern wirklich alle. Also auch die rassistischen! Was dabei für uns daher keinerlei Sinn macht, ist das Ausspielen des einen Anliegens gegen das andere. Wenn die Autorinnen etwa gegen Ende des Buches auf die Ambivalenzen von Schutzräumen innerhalb westlicher rechtsstaatlicher Demokratien hinweisen und das ausgerechnet mit dem Hinweis auf häusliche Gewalt gegen Frauen zu illustrieren versuchen. Denn für sie besteht ein Widerspruch zwischen Feminismus und Antirassismus bereits dort, wo „eine Anzeige wegen partnerschaftlicher Gewalt mit der Androhung einer potentiellen Abschiebung des Täters verbunden ist“ (263). Dem schließt sich die Behauptung an, dass sich diese Widersprüche „nicht auflösen“ lassen, sondern nur benenn- und angreifbar seien. Aber wäre nicht eher dafür zu kämpfen, dass auch diejenigen, die potentiell von rassistischer Gewalt betroffen sind, trotzdem nicht mehr Gewalt gegen ihre Frauen ausüben? Eine für Feministinnen wahrscheinlich recht leicht zu beantwortende Frage. Diese Art der aus dem Abstrakten schöpfenden Theoretisierung erweckt den Eindruck, Frauenrechte seien nur relevant, wenn sie nicht mit anderen Rechten oder Ansprüchen kollidieren.
Die Analyse des Rassismus ist ein wertvoller Beitrag zur Kritik von Herrschaftsverhältnissen. Eric Williams bahnbrechende Studie aus den 1940er Jahren „Capitalism and Slavery“ hat den Blick auf den Zusammenhang von rassistischer Gewalt und Kapitalverhältnis erweitert. Cedric J. Robinsons „Black Marxism“, hat die Rolle des Kampfes gegen die rassistischen Tendenzen des Kapitalismus im Rahmen einer Aneignung durch die politische Bewegung eines „Schwarzen Radikalismus“ wirkungsvoll thematisiert. Beides sind Konzepte der Politisierung der Kritik an Rassismus im Kapitalismus. Beide gibt es seit Jahrzehnten, sie müssten nicht begrifflich neu ausgepackt werden. Aber für die Kritik an der Gewalt gegen Frauen braucht man sie am aktuellen Stand der Diskurskräfte eventuell gar nicht. Denn so weit, dass Frauen den Luxus haben durchzuatmen und mal den Nöten von Männern Platz zu machen, sind wir noch nicht.
Darüber hinaus muss man konstatieren, dass nicht alle dekolonialen Perspektiven sich gleichermaßen intensiv mit dem Wohl von Frauen auseinandersetzen. Damit soll nicht gesagt werden, es gäbe keinen antirassistischen Feminismus. Unserer Überzeugung nach ist Feminismus immer auch antirassistisch, oder er ist eben keiner. Aber der Widerstand gegen postkoloniale (westliche) Gewaltstrukturen geht leider oft genug eher mit der Rechtfertigung nicht-westlicher patriarchaler Strukturen einher, als mit deren Kritik. Und so verwundert es dann doch ein wenig, wenn in einem Buch, in dem es doch in allererster Linie um Frauen gehen sollte, diese eigentlich beinahe nur eine Nebenrolle einnehmen.
Frauenmorde und davongekommene Täter
Begrifflich problematisch wird es aber, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass es um „feminisierte und/oder rassifizierte Menschen“ gehen soll. Was im akademischen Jargon zweierlei bedeuten kann: Menschen, die von äußeren Zuschreibungen zu Opfern gemacht werden, oder Menschen, die sich selbst aufgrund bestimmter äußerer Zuschreibungen als Opfer definieren. Der Verdacht, dass es zumindest teilweise auch um zweiteres gehen soll, bestätigt sich auf der nächsten Seite. Hier wird der Begriff „Protokolle der Angst“ erklärt, der im vierten Satz des ersten Kapitels eingeführt wird. Wir erinnern uns auch an den ersten Satz des ersten Kapitels, in dem ablehnend von akademischem Privileg die Rede war und machen uns bewusst, wie umfangreich und diffus dagegen der in den ersten paar Sätzen etablierte akademische Apparat bereits ist. Jedenfalls soll der Begriff der Protokolle der Angst zum Ausdruck bringen, dass „tägliche Erfahrung“ „das Erlernen sozialer Mechanismen“ mit sich bringt und diese dazu führen, dass sich feminisiert wahrnehmende Menschen, also FLINTAs, im Alltag oft Angst empfinden.
„Moralisierung von Verhalten und Körpern“
Und wir teilen die Kritik an der „Moralisierung von Verhalten und Körpern“ (22), die hier vorgestellt wird, die in allen Teilen der Welt in großer Hauptsache Frauen betrifft, aber wir müssen dennoch auf die unfreiwillige Komik verweisen, die entsteht, wenn die Autorinnen versuchen aus ihrer Perspektive zu beschreiben, wie (ihnen) „bei jeder unglücklichen Verkettung von Ereignissen […] das Unaussprechliche geschehen [kann]“. Wer durch das Vorwort aufmerksam durchgekommen ist, rechnet hier mit dem Schlimmsten, sicherlich ist das Unaussprechliche, darauf bezogen, dass weltweite massenhaft Frauenmorde geschehen und die Täter viel zu oft damit durchkommen. Dass Frauen entführt und zur Prostitution gezwungen, zwangsverheiratet, genital verstümmelt, zur Zwangsarbeit benutzt, als gratis Haus- und Pflegehilfe milliardenfach ausgebeutet werden, als Kriegstaktik massenvergewaltigt und weibliche Föten wegen Erbregelungen zu hunderttausenden zugunsten eines Sohnes abgetrieben werden. Aber darum geht es an dieser Stelle nicht, unaussprechlich ist vielmehr ein viel niedrigschwelligeres Erleben, das, in der Art wie es hier vorgetragen ist, in Teilen, jedem passieren kann, nicht nur Frauen.
Das Gefühl vermittelt zu bekommen, nichts wert zu sein
„Unsere Körper werden ungewollt berührt; Autoritätspersonen überschreiten ihre Kompetenzen und Grenzen; Äußerungen zwingen uns zur Rechtfertigung; Freund*innen und Bekannte unterstellen etwas, womit wir nicht gerechnet hätten; ein ungutes Gefühl beim Nachhausekommen; das Gefühl vermittelt zu bekommen, nichts wert zu sein; nach der Arbeit; am Ende einer Party oder auf der Straße spricht uns eine Person an; die Blicke bringen uns in unangenehme Situationen – Erfahrungen die unser Leben gefährden können.“ (22)
Es stimmt, was die Autorinnen danach schreiben, die Angst kann zur Gewohnheit werden und ist für Frauen im Alltag immer vorhanden, und sie immer wieder auf unterschiedliche Arten zu thematisieren, ist Teil des publizistischen feministischen Kampfes. Aber wenn es schon ein Übergriff ist, wenn man sich durch Äußerungen anderer zur Rechtfertigung angehalten sieht, dann geht es nicht um Feminismus, sondern um Befindlichkeit.
Aufarbeitung der historischen Gewalt
Trotzdem interessant zu lesen, ist das Buch immer dort, wo es um die Aufarbeitung der historischen Gewalt geht, wo konkret an der Problematik gearbeitet wird. Das Kapitel „Die Politisierung von Femi(ni)ziden von Mexiko bis Argentinien“ beginnt mit der akademischen Klammer, dass die zehntausenden verschwundenen, in die Sklaverei verkauften und wahrscheinlich letztendlich ermordeten Frauen in Mexiko als „als Frauen gelesene Personen“ (35) angesehen werden müssen, was angesichts der sehr wahrscheinlichen prozentuellen absoluten Mehrheit von schlicht Frauen, die dieses Schicksal erleiden müssen, einen unangenehmen Beigeschmack der akademischen Relativierung mit sich bringt. Es ist aber ansonsten informativ und on point.
Das darauffolgende Kapitel über die analytische Perspektive auf das Thema zeigt aber wieder, wie schwer sich die Autorinnen von den rein akademischen Gefolgschaftsdebatten lösen können, die wohl ihre Lebenswelt in erster Linie bestimmen. Denn kaum ist die genealogische Kritik, die Identifizierung von Gewaltverhältnissen und die Infragestellung rechtfertigender misogyner Narrative ein wenig in Schwung gekommen, muss gleich wieder das queere akademische Racket mit theoretischen Relativierungen ruhiggestellt werden. So ist den Autorinnen die Kritik am Patriarchat, die auf den vorigen Seiten beinahe begonnen hätte, so unheimlich, dass sie klarstellen müssen auch eine Kritik an „feministischen Theorien, die ‚Frausein‘ als universell und homogen darstellen“ (54) vornehmen zu wollen. Wobei sie mit der Behauptung arbeiten, solche Theorien würden „unterschiedliche verkörperte Erfahrungen als unterlegen oder unbedeutend präsentieren und unsichtbar machen“ (54). Welche Theorien das genau sind, wird nicht an Primär-Quellen belegt, das wäre auch schwer, sondern nur an der Literatur, die diese imaginierten rein binären feministischen Theorien kritisieren.
„Abgrenzung“ von „der ersten Generation der Kritischen Theorie“
Dem entspricht die, in den Rängen des Postfeminismus Beifall heischende, ansonsten eher dunkel bleibende „Abgrenzung“ von „der ersten Generation der Kritischen Theorie“ (55), die damit, wie schon zu Weiland Heideggers Zeiten, als uncool verfemt wird, ohne, dass dies inhaltlich in irgendeiner Form belegt wird. Denn der Bezug auf die Originalquellen bleibt auf ein zustimmend verwendetes Zitat von Max Horkheimer beschränkt. Der Aufweis des, feministisch betrachtet, unkritischen Charakters der sogenannten Kritischen Theorie wird durch ein indirektes Zitat aus einem Aufsatz von Barbara Umrath von 2018 erledigt, dem zu entnehmen ist, dass „in den älteren Texten […] eine systematische Beschäftigung mit patriarchalen Strukturen und Geschlechterverhältnissen aus[bleibt], oder […] zumeist affirmativ oder abwertend auf ‚Weiblichkeit‘ oder ‚Familie‘ Bezug genommen“ (59) wird. Was mindestens beim Studium der Schlüsselwerke Kritischer Theorie, wie der „Dialektik der Aufklärung“, als überzogen bezeichnet werden kann. Denn gerade dort wird die Gesellschaftskritik auch als Kritik der Geschlechterverhältnisse vorgetragen, in Opposition zum Nationalsozialismus und lange bevor es akademische Mode wurde.
Kritische Theorie und Feminismus
Diesem Vorurteil hätte man durchaus am Stand der Forschung begegnen können und sich mit Karin Stögners und Alexandra Colligs, ein Jahr vor dem Femi(ni)zide-Band erschienenen, Buch „Kritische Theorie und Feminismus“ (Suhrkamp) auseinandersetzen, um zu dem Ergebnis zu kommen: „Wenngleich also Kritische Theorie nicht explizit feministisch genannt werden kann, ist sie doch Impulsgeberin für feministische Theorien, seien es materialistische, dekonstruktivistischer, normative oder queere und intersektionale Richtungen.“ (Stögner/Colligs 2022: 13)
Das ficht die Autorinnen jedoch nicht an, sie sind auf S. 60 beinahe völlig weggekommen von der Kritik patriarchaler Gewalt, wenden sich der Kritik eines „weißen, bürgerlichen, heteronormativen und cis-orientierten Feminismus“ (60f.) zu und fordern „Feminist*innen“ zur „stets neuen Reflexion“ (61) auf. Was sollten Feminist*innen angesichts patriarchaler Gewaltstrukturen auch Besseres zu tun haben?
Warum diese scheinbar rein akademischen Plänkeleien nicht nur Theoriedünkel und persönliche Präferenzsysteme zum Ausdruck bringen, wird dann auf den nächsten Seiten sichtbar, wenn es um feministische Kampfmöglichkeiten geht. Feministischer Streik liegt in der Luft und „bewegt sich im Spannungsfeld von konkreter verkörperter Erfahrung und struktureller Kritik“ (64). Das Ziel soll aber offenbar nicht in erster Linie das kämpferische Niederringen männlicher Vorherrschaft über die Einteilung von Hausarbeit für Frauen sein, sondern „Begriffe und Konzepte, die innerhalb einer gesellschaftlichen Ordnung als Normen gelten und so diese Gewalt ermöglichen und herstellen“ (65) zu hinterfragen. So weit, so abstrakt.
Normen die Gewalt gegen Frauen ermöglichen
Aber der Clou kommt noch, denn wenn man fragt, was diese Normen sind, die diese Gewalt gegen Frauen ermöglichen, dann erhält man eine Antwort, die ein wenig unbefriedigend ist, wenn man sich auf die zuvor angekündigte „dialektische Einheit von Theorie und Praxis, die sich gegenseitig bedingt, aber nur ‚als Konflikt‘ bestehen kann“ (59) verlassen hat. Denn die Gewaltverhältnisse basieren auf der bürgerlich heteronormativen Familie, dem rassistischen Nationalstaat und der binären Geschlechterordnung (65). Also allem, was bereits den Hippies verhasst war und mithin die klassische Leier von der Autorität. Dass aber die Familie, auch aus sozialarbeiterischer Perspektive, eine wichtige Quelle von Stabilität für die Individuen sein kann, der demokratische Rechtsstaat besonders gegenüber Individualrechten im Allgemeinen und Frauenrechten im Speziellen historisch und aktuell einfach essentiell ist und dass die binäre Geschlechterordnung selbst noch nicht zu Gewalt führen muss, wird hier fern von jeder Dialektik einfach mal unter den Tisch fallen gelassen. Das geht so weit, dass gewaltvoller gesellschaftlicher „Ausnahmezustand“ als „Normalzustand“ imaginiert wird.
Auf der Seite der Gewalt der Kollektive
Das verwundert aber nicht, wird doch bereits im Untertitel des Buches ein Kategorienfehler angekündigt, der sich durch das gesamte Buch zieht: „Kollektiv patriarchale Gewalt bekämpfen“ bedeutet ja, als Kollektiv kämpfen. Aber gesellschaftliche Gewalt, zumal die der Verhältnisse gegen die Individuen, entsteht ja erst durch kollektive Zwänge. Nur im Kollektiv kann ein binäres Geschlechterverhältnis überhaupt existieren und nur durch die Macht kollektiver Verbrüderung, unter Einbezug einiger Frauen, kann die Unterdrückung der Frauen aufrechterhalten werden. Aufgrund dieses Kategorienfehlers sind die Autorinnen immer ein wenig auf der Seite der Gewalt der Kollektive, denen sie die Frauen ja eigentlich entziehen müssten, um deren individuelle Unversehrtheit garantieren zu können. Daher thematisieren sie die Religion, einen der zentralen Faktoren der Unterdrückung und Verfolgung von Frauen und Homosexuellen weltweit, eben nicht an der Stelle ihrer analytischen Perspektive auf die gesellschaftlichen Gewaltstrukturen, sondern an zwei anderen Stellen, wo es weniger um die Rolle der religiösen Zwangskollektive, als um staatlichen und mehrheitsgesellschaftlichen Rassismus geht. (117ff. und 226ff.)
Niemand braucht noch mehr Gewalt gegen Frauen
Darin liegt wiederum eine eigene Wahrheit. Denn natürlich ist die Vorstellung, dass Gewalt gegen Frauen durch den Zuzug von Menschen aus als rückschrittlich geframten Ländern erst importiert wird, sowohl rassistisch als auch blind den Tatsachen männlicher Gewalt gegenüber. Denn natürlich hat auch Österreich eine Jahrtausende andauernde Kultur des Frauenmords, die ungebrochen weiterbesteht und bräuchte diesbezüglich gar keine Importe. Aber das ist dann auch der Punkt: Niemand braucht noch mehr Gewalt gegen Frauen. Und deshalb sollte diese auch nicht indirekt dadurch gerechtfertigt werden, dass man sie aus politischer Korrektheit heraus nicht bespricht.
Abgesehen davon bleibt auch die organisierte kirchliche Gewalt gegen Kinder außen vor. Als wären nicht gerade religiöse Zwangskollektive mittels der Instrumentalisierung des binären Geschlechterverhältnisses zu den mächtigsten Akteuren der Moralisierung des Körpers aufgestiegen. Aber wahrscheinlich würde das zu weit führen …
Verwendung des Begriffs Feminizid
Diese Linie zieht sich im weiteren Verlauf des Buches durch. Es wird Begriffskritik vor die Kritik der Verhältnisse gesetzt. (71) Wir schließen uns der Aussage an, dass das „Spektrum patriarchaler Gewalt […] breit“ (74) ist und eine „zentrale Dimension patriarchaler Gewalt [darin besteht], dass sie nicht beim Namen genannt wird“ (76). Aber uns würde nicht einfallen, daraus die Frage zu basteln, ob durch die Verwendung des Begriffs Feminizid „‚das Feminine‘ essentialisiert und essentialistisch reproduziert wird“ (77). Auch deshalb, weil sich diese Frage nur stellt, wenn sie gegen das Interesse des expliziten Schutzes von Frauen gestellt wird. Denn worauf die Frage am Ende des Abschnitts abzielt, ist natürlich nicht, die Herabwürdigung von Weiblichkeit im Diskurs über Gewalt gegen Frauen anzuklagen, sondern darauf nicht nur patriarchale und misogyne Muster der gesellschaftlichen Gewalt gegen Frauen zu thematisieren (die religiösen Muster bleiben auch hier draußen), sondern um „transfeindliche Muster“ (78) an deren Seite zu stellen. Dieses Muster wird in Form einer mäandernden Sprachübung durch die folgenden Kapitel fortgesetzt. Der Text scheint nicht vom Fleck zu kommen, immer wenn es konkret zu werden scheint, folgt ein neuer Exkurs zur Begriffskritik, bleibt die Präsentation der Materie selbstreferentiell und auf den akademischen Spezialdiskurs bezogen oder hält sich bei Allgemeinplätzen auf, wie dem, dass es bei der Aufrechterhaltung der Gewaltverhältnisse um Macht und Kontrolle geht. (107)
Mit dem Kapitel Protestformen erreicht das Buch, trotz der Umwege, eine sehr lesenswerte Form, in der es endlich um das sprichwörtliche Eingemachte geht. Eine schnörkellose Geschichte politischer Proteste, ihrer Wege und Wirkungen, die in dem Kapitel „Überlegungen zu Zählungen, Begriffen und Benennungen“ mündet, das gefüllt ist mit nützlichen Definitionen und Erläuterungen zum Thema. Also das, was man sich von dem Buch erwartet: Mittel zur Aufklärung und Politisierung der schlechten Verhältnisse, anstatt akademischem Sonderdiskurs mit relativistischen Tendenzen.
Fazit zum Buch
Das Buch ist lesenswert und wird hier ausdrücklich empfohlen. Es gibt nützliche Perspektiven im Umgang mit dem Begriff des Femi(ni)zids und eine Darstellung politischer Aktionsformen, die vermehrt zur Nachahmung anregen sollten.
Aber es bleibt dennoch die bittere Erkenntnis, dass wir im feministischen Kampf, trotz aller erkämpfter gesellschaftlicher Akzeptanz, zusehends allein dastehen. Denn, obwohl es die Intention des Buches ist aufzuklären, wird darin mittels akademisch anschlussfähiger postfeministischer Rhetorik mindestens ebenso viel verdunkelt.
Der Skandal an dieser Rhetorik ist, dass sich Frauen, wenn es um den Mord an ihnen geht, als Betroffene gerade noch mitgemeint fühlen dürfen. Es geht nicht um sie, es geht um alles andere und dann irgendwann auch noch vielleicht um sie. Wenn, so wie die postfeministische Theorie das gerne hätte, davon ausgegangen wird, dass Sprache Realität erzeugt, dann ist das ein unverzeihlicher Lapsus für ein Buch, das sich gegen den Mord an Frauen einsetzen will. Wenn Sprache politisch ist, dann ist die Marginalisierung von Frauen, in einem Text in dem es um die Kritik an der ständigen gesellschaftlich sanktionierten Ermordung von Frauen gehen sollte, ein antifeministisches Projekt.