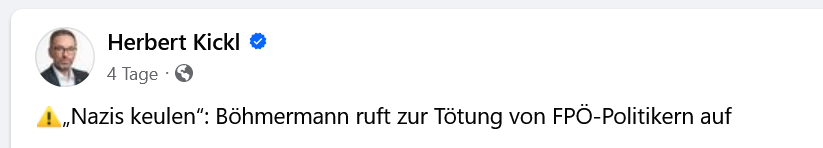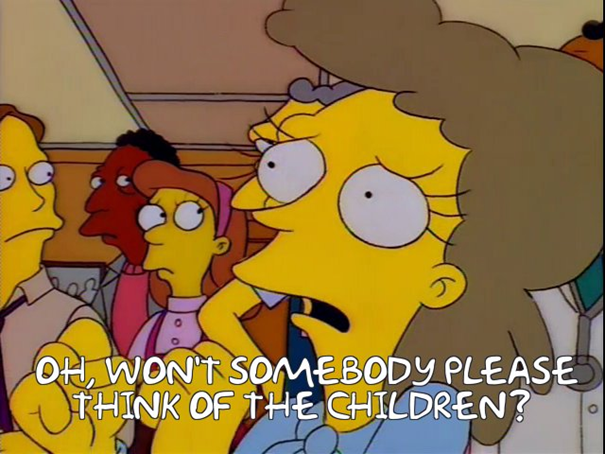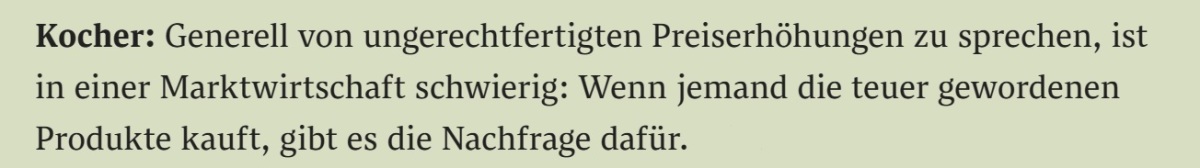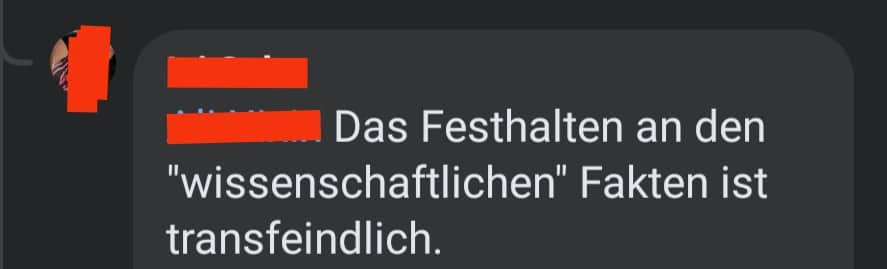Die Journalisten Lars-Broder Keil und Sven Felix Kellerhoff haben vor einigen Jahren ein brauchbares Buch über Fakenews geschrieben, in dem sie sich mit der Verbreitung von Falschmeldungen im 20. und 21. Jahrhundert auseinandergesetzt haben. Auf dem Cover sind Toupet und Augenbrauen von Donald Trump abgebildet, dem aktuellen Ku-Klux-Klan-Führer der rechten Fakenews Bubble. Die Fakenews von rechts (dazu zähle ich auch religiösen Extremismus) sind brandgefährlich, sie wirken oft als Hetze und Auslöser von Gewalt. In Zeiten des steigenden Antisemitismus haben wir es zugleich mit einem Phänomen gewaltauslösender Fakenews von links zu tun, die denen der religiösen und extremistischen Rechten oft ähneln.
Das ich jetzt trotzdem über einen Vorfall aus der linksliberalen Bubble spreche, die im Grunde wohlmeinend und harmlos ist, und nicht über die unzähligen qualitativ viel schlimmeren Entgleisungen rechter Bubbles, die mir durchaus bewusst sind, liegt an der Subtilität und Selbstverständlichkeit, mit der in diesem Fall Fakenews produziert werden. Oder besser gesagt, wie Fakenews auch entstehen können, wenn man vielleicht die besten Absichten verfolgt, aber nicht auf gewisse Formalitäten Acht gibt und nicht den eigenen gesellschaftlichen Standort reflektiert.
Ausgangspunkt ist ein Posting, das einen Satz aus einem Online-Artikel entnimmt und diesen ohne Quellenangabe als Ausgangspunkt für eine Meinungsäußerung verwendet. Der ohne Angabe der Quelle aus einem Online-Artikel kopierte Satz besagt: „Die Zahl der angezeigten Straftaten in Wien ist in den vergangenen zehn Jahren um 7,8 Prozent gesunken, die Zahl der Verurteilungen sogar um 27 Prozent.“
Der Teilende schreibt dazu: „Immer wieder die Rede, dass es in Wien inzwischen so gefährlich sei, dass man sich des abends oder nächtens gar nicht mehr aus dem Haus traue.“
So weit so gut. Klingt auf den ersten Blick nach einer guten, positiven Nachricht. Macht euch keine Sorgen, es geht aufwärts. Auf den zweiten Blick liegt in der Formulierung der Meinung, dass immer wieder die Rede davon sei, es wäre gefährlich und man können sich nachts nicht mehr hinaustrauen, natürlich auch ein Vorwurf. Jeder, der das subjektive Gefühl hat, es wäre unsicher auf manchen von Wiens Straßen, ist irgendwie anrüchig. Gemeint ist vermutlich, wer sagt, er hat Angst rauszugehen wegen der Kriminalität, ist ein Angsthase, oder schlimmer, ein Verbreiter von Angst. Also eigentlich keine positive Botschaft, sondern ein Vorwurf und zwar ein Vorwurf an bestimmte Menschen. Ich komme darauf später noch zurück.
Auf meine Frage, woher das Zitat, aus dem sich die Aussage ableitet, stammt, kommt als Antwort ein Link zu einer, von mir gern gelesenen, Wiener Zeitschrift mit einem hohen Qualitätsanspruch. Ich lese und stelle erstaunt fest, dass zu den genannten Zahlen auch hier keine Quellenangabe vorhanden ist. (Stand 03.04.2025, 09:34, Screenshot vom Letztstand vorhanden) Das bedeutet, derjenige, der das Posting gemacht und das Zitat geteilt hat, hat selbst keine Ahnung, ob die Aussage stimmt, die er da teilt. Das ist ein Kriterium der Verbreitung von Fakenews, nach Keil und Kellerhoff, und eine Methode auf die Trump und seine Anhänger oft zurückgreifen, nach dem Schema: „Ja es gibt schon Fakten, aber der Onkel von meiner Schwester hat gesagt, dass … bzw. Der Abgeordnete meiner Partei, der dieselbe Meinung zu dem Thema teilt wie ich, hat bereits vor Jahren gesagt, dass …“ usw. Darüber hinaus teilt er aber auch nicht mit, dass er die Aussage nicht überprüft hat und sie auch nicht überprüfen kann, weil die Ursprungsquelle das nicht zulässt.
Auf meine weitere Nachfrage kommt die Antwort: Ich solle bei der Autorin selbst nachfragen. Da ich die Autorin nicht persönlich kenne und sie auch nicht als Kontakt auf der Plattform habe, lasse ich das. Cyberstalking ist nicht schick. Als Alternative recherchiere ich selbst und stoße auf das Statistische Jahrbuch für Wien, das für den Zeitraum von 2019 bis 2023 zuerst einen leichten Rückgang und dann einen Anstieg der strafbaren Handlungen ausweist. Die Statistik für 2024 ist noch nicht veröffentlicht. Ich poste diese Info zu meiner Frage und damit ist für den Ursprungs-Poster die Diskussion beendet. Ich erhalte jedenfalls keine Antwort mehr. Das Ursprungs-Posting wird aber nicht modifiziert oder mit Anmerkungen versehen und zieht weiterhin Leser_innen an, die sich in ihrer Weltsicht bestätigt sehen und das auch kundtun. Der Tenor ist: Ja stimmt, fühle mich safe wie nie. Finde ich super. Unterstütze ich. Ich bin auch der Überzeugung, dass diffuse Angstgefühle ohne objektive Grundlage zu sehr schlechten gesellschaftlichen Entwicklungen führen und dass man das mit allen Mitteln bekämpfen sollte. Vor allem durch Aufklärung und haltbare Information.
Jetzt ist es aber so, dass die oben genannte Aussage in mehrere Hinsichten irreführend ist. Erstens stimmt sie nicht mit der in der Statistik ablesbaren Entwicklung überein. Also, selbst wenn es eine Tendenz über zehn Jahre gibt, dass die Zahl der „angezeigten Straftaten“ (dazu später mehr) zurückgegangen ist, bedeutet es nicht, dass es auf den Straßen Wiens sicherer geworden ist. In den Straftaten sind auch Internetkriminalität und Zechprellerei enthalten, die wohl auf die subjektive Wahrnehmung der Sicherheit auf den Straßen wenig Einfluss haben.
Zweitens stammt die Information, laut der durch den Poster mitgeteilten Aussage der Autorin, von Polizei und Bezirksgerichten und ist (noch) nicht schriftlich, statistisch, zugänglich. Das ist auch ok, aber wäre cool das auch dazu zu schreiben. Abgesehen von dem kleinen Makel, dass Polizei und Gerichte natürlich ein Interesse daran haben ihre Arbeit als effizient darzustellen, und man deren Aussagen deshalb vielleicht nochmal gründlicher überprüfen sollte.
Was mich daran aber sehr nachdenklich macht, ist die Selbstverständlichkeit, mit der von beinahe allen sonstigen Kommentatorinnen diese nicht gekennzeichnete, nicht nachvollziehbare Aussage einfach akzeptiert wird, weil sie ins persönliche Weltbild passt. Abgesehen davon, dass es natürlich ein logischer Fehlschluss ist, anzunehmen, die Stadt sei sicherer geworden, nur weil die Verurteilungen von Straftätern zurückgegangen sind! Das kann sehr viele Gründe haben, die nichts mit einer Verbesserung der Situation zu tun haben. Gerichte etwa können mit der Zahl der Anzeigen überfordert sein und Urteile aussetzen. Noch besorgniserregendere Gründe könnte der Rückgang von Anzeigen haben. Etwa, dass Betroffene von Verbrechen der Polizei misstrauen. Sich von ihr keinen Schutz erwarten, oder Erfahrungen mit rassistischen Beamten gemacht haben. Vielleicht folgen sie auch einem Ehrenkodex, wie ihn die Mafia vorschreibt, und verpetzen einander nicht. Es gibt viele Möglichkeiten diese Entwicklung auszulegen und nur im Idealfall haben sie mit einer durchwegs positiven Entwicklung zu tun.
Der zweite Fehlschluss mancher Kommentare liegt darin die Ebene des persönlichen Sicherheitsgefühls mit der einer statistischen Entwicklung zu verbinden. Was den impliziten Vorwurf an die Angsthasen und Angstmacher dann noch unerträglicher macht, da man ja im Positiven genau das macht, was man ihnen dann im Negativen vorwirft. Das persönliche Sicherheitsgefühl von materiell abgesicherten, gut gebildeten und gesunden Menschen ist tendenziell höher als das von armen, alten, kranken Menschen. Aussagen nach der Manier: „Dass es gefährlicher geworden ist, wäre mir nicht aufgefallen“, sind also äußerst vermeidlich und bringen eher den Dünkel einer bestimmten gesellschaftshierarchischen Position gegenüber niedrigeren Klassen und allgemein Schwächeren zum Ausdruck. Pierre Bourdieu hat das ausführlich beschrieben und kritisiert.
Ich unterstelle keine böse Absicht. Ich versuche den Mechanismus der Fakenews in seiner subtilsten Form nachvollziehbar zu machen. Der Poster wollte sagen: „Habt keine Angst, es wird alles gut.“ Was er gesagt hat, ist etwas perfider. Denn natürlich gibt es ein Problem mit Verbrechen in Wien und natürlich ist es möglich ein Opfer von Gewalt zu werden. Die öffentliche Wahrnehmung orientiert sich ja am Sichtbaren und am Naheliegenden. Laute überdrehte Jugendliche haben Menschen zu allen Zeiten Angst gemacht. Meist zu Unrecht. Aber die Zahlen zeigen eben auch einen Anstieg in einem Segment der Verbrechen und das sind die Gewalttaten, die laut Innenministerium von 2022 auf 2023 um über 8% gestiegen sind. (https://www.bmi.gv.at/magazin/2024_05_06/02_Kriminalstatistik_2023.aspx)
Darüber hinaus passiert hier aber weit mehr, als dass logische Denkfehler gemacht und unbelegte Zitate verbreitet werden. Denn was sagt das Narrativ von den Ängstlichen und den Angstverbreitern denn noch aus? Es sagt: „Hören wir denen nicht zu.“ „Sprechen wir nicht darüber.“ Es gibt einen Missstand, aber es sollen keine Wellen gemacht werden. Es wird ja eh besser, laut unbelegter Quelle. Die von der Gewalt betroffenen, und sei es nur, weil sie davon eingeschüchtert sind, sollen die Pappn halten. Es geht hier um die, mit Techniken der Fakenews unterstützte, Verbreitung eines Ressentiments. Eines Ressentiments, das umso verwerflicher ist, als die Betroffen von Gewalt auf Wiens Straßen meist Sandler, die Armen, die strukturell Benachteiligten, die Alten, die Kranken, diejenigen die es ohnehin im Alltag schwer haben, sind. Aber auch die rassistisch ausgeschlossenen sind Opfer der Gewalt. Viel häufiger als es dokumentiert wird, spielt sich die Gewalt unter ihnen ab und wird dann dementsprechend oft nicht zur Anzeige gebracht. Sie sind eben nicht nur Täter, wie das die rechten Fakenewsverbreiter gerne darstellen wollen, sondern überproportional auch Opfer. Und auch darüber sollte man reden. Es hat in der Geschichte den unteren Klassen nie zum Vorteil gereicht, wenn über Probleme nicht geredet werden durfte.
Edit: Natürlich wurde ich nach meinen Einwänden, noch bevor der Blogpost hier fertiggestellt war, entfreundet. Da sind sich die linksliberalen Künstlerbubble-Bewohner mit Trump und Musk einig. Widerspruch wird als narzisstische Kränkung erfahren und nicht geduldet.
Edit 2: Die Auftritte von Florian Klenk und vom Falter auf Fb haben mich beide seither ebenfalls kommentarlos blockiert.