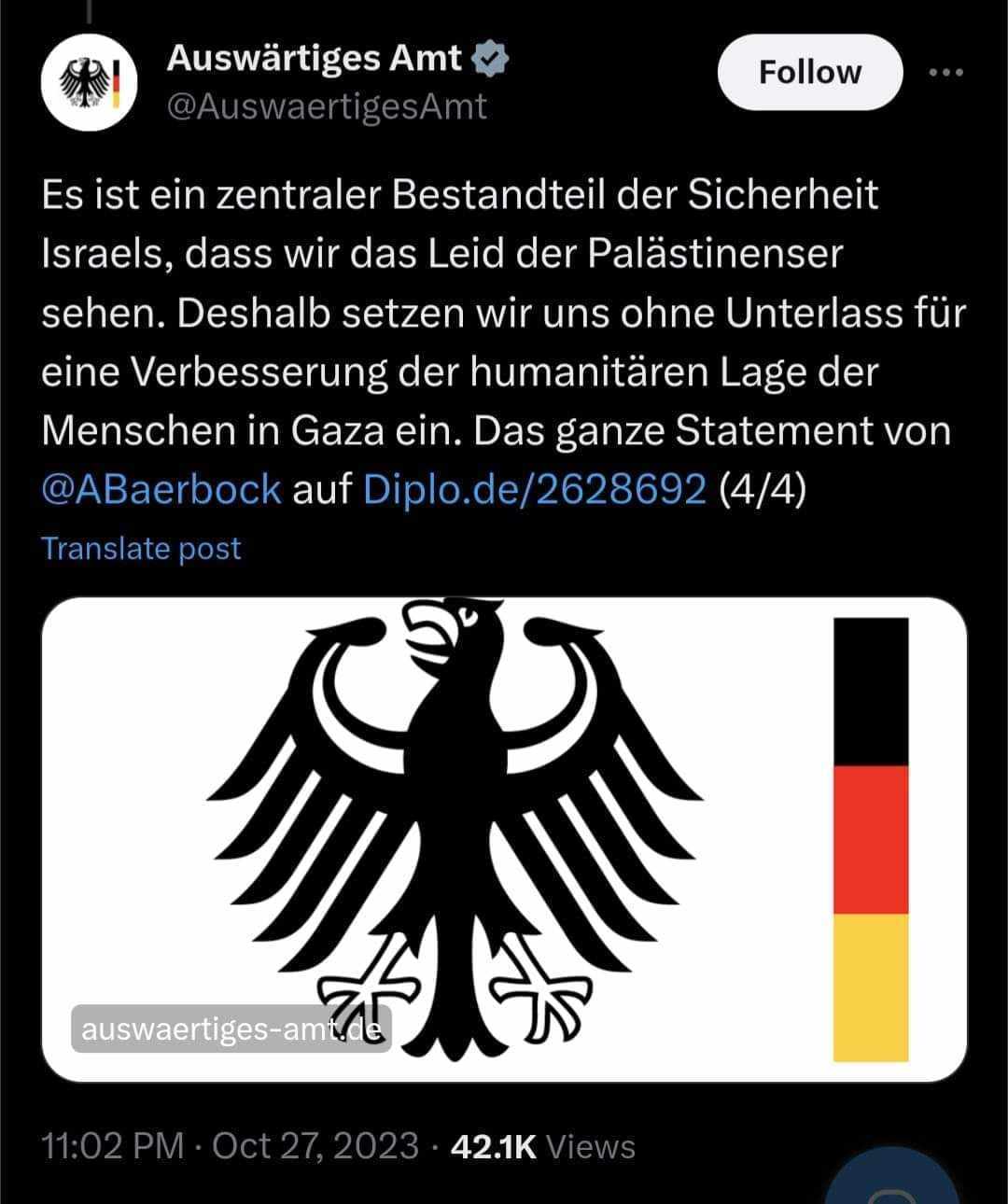Anfang Jänner 2024 sind gleich zwei Bücher über Antisemitismus in deutschen Verlagen erschienen, deren Gegenüberstellung auch in Anbetracht der „rastlose(n) Selbstzerstörung der Aufklärung“, mit der wir uns täglich konfrontiert sehen, notwendig ist. Es handelt sich dabei um Texte, die bereits in den 1960ern bzw. 1970ern entstanden sind, und die wohl auch deshalb gerade prädestiniert sind, ihre Aktualität an der unerträglichen Gegenwart messen zu lassen. Es geht um Theodor W. Adornos Rede „Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute“, 2024, Suhrkamp Verlag, und Jean Amérys „Der neue Antisemitismus“, 2024, Klett-Cotta.
Hochmotiviert schickte ich mich also an, um je ein Belegexemplar der Bücher anzufragen. Bei Klett-Cotta bekam ich sofort ein Exemplar zugeschickt, vom Suhrkamp Verlag erhielt ich die Information das „Kontigent an Rezensionsexemplaren“ sei „begrenzt“. An irgendwelche dahergelaufenen Blogger könne man also keine Bücher mehr ausgeben. Nicht einmal für das derzeit in der Buchbranche relativ beliebte obligatorische PDF war wohl noch Geld da. Schweren Herzens entschied ich mich also meine letzten zehn Euro dem Suhrkamp Verlag zu spenden, der diese wohl dringlicher braucht als ich.
Im Winter 1962 hielt Adorno in Wiesbaden bei einer Tagung des Deutschen Koordinierungsrats der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit einen Vortrag mit dem Titel „Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute“, der im Suhrkamp Verlag nun in Buchform vorliegt. Zunächst hinterfragt Adorno die Behauptung der „Meinungsforscher“, dass der Antisemitismus „kein aktuelles Problem“ in Deutschland sei, eine Formel, der man auch heute wieder bis recht kürzlich gerne anhing – ausgenommen davon natürlich rechtsextreme Formen von Antisemitismus. Adorno betont Antisemitismus als „Teil eines ‚Tickets‘“, als „Mittel“ ansonsten „divergierende() Kräfte eines jeden Rechtsradikalismus auf die gemeinsame Formel zu bringen“ (12).
Dass der Antisemitismus nicht nur „divergierende Kräfte“ des „Rechtsradikalismus“ eint, sondern noch ganz andere Kräfte, die sich bis vor kurzem noch spinnefeind waren, sieht man bei Betrachtung der Querfronten, die sich seit dem siebentem Oktober 2023 gebildet haben. Nur zu bekannt klingen da auch Adornos damalige Worte über jene, die sich „derart (…) dem Gerücht zuwende(n)“. Auch auf der einen oder anderen Demonstration gegen Israel finden sich genug Menschen, die sich als Teil einer „heimlichen, wahrhaften und durch die Oberflächenformen der Gesellschaft nur unterdrückten Gemeinschaft“ (16) imaginieren. Niemand interessiere sich für das Leid der Palästinenser, alle Medien seien auf Seite der Israelis, nichts könne man öffentlich sagen, brüllt es da im Chor tausender Stimmen ins Megaphon.
Adorno nennt diese Art der Selbstdarstellung einen der „wesentlichen Tricks von Antisemiten“, die Tendenz „sich als Verfolgte darzustellen; sich zu gebärden, als wäre durch die öffentliche Meinung, die Äußerungen des Antisemitismus heute unmöglich macht, der Antisemit eigentlich der, gegen den der Stachel der Gesellschaft sich richtet, während im allgemeinen die Antisemiten doch die sind, die den Stachel der Gesellschaft am grausamsten und am erfolgreichsten handhaben“ (16-17).
Das beliebte Argument führe zur Schlussfolgerung, „wenn man nichts gegen die Juden sagen (dürfe), dann (…) sei an dem, was man gegen sie sagen könnte, auch schon etwas daran.“ Dies bezeichnet er als „Projektionsmechanismus“, durch den „die Verfolger (…) sich aufspielen, als wären sie die Verfolgten“ (27), ein Phänomen, das man bei Karl Kraus als „verfolgende Unschuld“ kennengelernt hat, und das, in Bezug auf Antisemitismus, der Soziologe David Hirsh später konkreter als Livingstone-Formulierung bezeichnete: eine Verweigerung sich mit einem Antisemitismus-Vorwurf auseinanderzusetzen, und dem Ankläger stattdessen vorzuwerfen, dieser sei an einer Verschwörung zur Unterdrückung der Redefreiheit beteiligt.
Nach Adorno führt der „Krypto-Antisemitismus (…) von selbst auf den Autoritätsglauben“ (17). Adorno kommt auch auf Möglichkeiten zu sprechen eine solche Form von Antisemitismus langfristig zu bekämpfen: einerseits, bei Kindern die noch formbar seien, durch den Versuch einer Ausbildung des autoritären Charakters entgegenzuwirken, bei jenen, wo diese Charakterstruktur sich aber bereits verfestigt habe, dürfe man nicht davor zurückscheuen, ebendiese von ihnen geliebte Autorität gegen sie zu wenden, „um ihnen zu zeigen, daß das einzige, was ihnen imponiert, nämlich wirklich gesellschaftliche Autorität, einstweilen denn doch noch gegen sie steht“ (18).
Der „antisemitische Charakter“ sei „wirklich der Untertan“, „die Radfahrernatur“, er gebe sich rebellisch, sei aber „ständig bereit, vor den Trägern der wirklichen Macht, der ökonomischen oder welcher auch immer, sich zu ducken und es mit ihr zu halten“ (34-35). Gleichzeitig sei Antisemitismus heute, anders als zur Zeit Hitlers, nicht so stark durch die väterliche Brutalität geprägt, sondern durch „Impfung“ im Elternhaus und familiäre Kälte (36-37), welcher man pädagogisch entgegenzuwirken habe, ebenso wie Gruppen- und Cliquenbildung, welche dem Phänomen des Antisemitismus ähnle. Es seien stattdessen individuelle Freundschaften zu fördern (40-41). Ebenso wichtig sei es, die „Identifikation von Juden und Geist“ zu brechen, das Vorurteil also, das Bildung mit dem Judentum identifiziert und Antiintellektualismus fördert, mit dem zur Zeit des Nationalsozialismus der Dualismus zwischen Geist und Geschicklichkeit (Körper) festgeschrieben wurde (44-45).
Adorno bezeichnet Antisemitismus als „Massenmedium“, das sich an bereits vorhandene unbewusste Neigungen anhaftet und diese potenziert, anstatt sie bewusst und damit „lösbar“ zu machen (22). Antisemitismus sei strukturell verwandt mit dem Aberglauben und der Propaganda und immer antiaufklärerisch. Adorno sieht in der massenmedialen Verbreitung, einer „rationale(n) Fixierung irrationaler Tendenzen“, eine der „gefährlichsten ideologischen Kräfte in der gegenwärtigen Gesellschaft“ (22). Man müsse sich daher gegen „alles Reklameähnliche wehren“ (23), auch im Kampf gegen den Antisemitismus, mit „empathische(r) Aufklärung, mit der ganzen Wahrheit, unter striktem Verzicht auf alles Reklameähnliche“ (24). Und an Reklame fehlt es in der medialen Berichterstattung um den Nahost-Konflikt und der demonstrativen Zurschaustellung auf diversen Kundgebungen nicht, in der schlagworthaften Verwendung von Begriffen wie „Genozid“, „Apartheid“, „Siedler-Kolonialismus“, „Kindermörder Israel“ etc., sowie der mantraartigen Wiederholung von „From the River to the Sea …“ und anderen Schablonen.
Adorno schlägt vor, sich erst gar nicht mit der Wiederlegung von „irgendwelche(n) Fakten und Daten, die nicht absolut sicher sein sollen“ zu befassen (25). Er bezieht sich hier explizit auf Trickgriffe der Holocaustleugnung, die Anzweiflung von 6 Millionen getöteten Juden. Heute zeigt sich ein ähnliches Muster auch wieder im Zweifel an den Zahlen der getöteten Israelis vom 7.10.23, den Vergewaltigungen israelischer Zivilistinnen; in vielen Fällen sogar im Zweifel daran, dass überhaupt etwas geschah. Adorno legt nahe, sich erst gar nicht auf „eine unendliche Diskussion innerhalb von Strukturen“ einzulassen, „die von den Antisemitinnen gewissermaßen vorgegeben sind“, da man hierbei wiederum „deren Spielregeln sich unterwerfen würde“. Die komplexe Wahrheit sei immer vorzuziehen, man solle sich nicht auf diverse Spielereien mit Zahlen und auf ein Aufrechnen einlassen (25).
Hier geht Adorno auch kurz auf die „Dresdner Verteidigung“ ein, jenes Tu-quoque-Argument, das bereits in den Nürnberger Prozessen durch die Verteidigung der Nationalsozialisten zur Anwendung kam, in der eine Gleichstellung der gezielten und grausamen Ermordung von Jüdinnen und Juden und des Vernichtungsantisemitismus der Nazis, mit der Tötung von Zivilistinnen bei der Bombardierung von Dresden versucht wurde. Das Deutsche Nachrichtenbüro hatte zudem direkt nach dem Luftangriff die Zahlen toter Zivilist*innen bereits stark übertrieben und als Massenmord dargestellt – die Rede war hier von 100.000-200.000 Opfern, heute geht man von ca. 25.000 Toten aus. Adorno besteht darauf, dass keiner bestreite, dass auch diese Bombardierung furchtbar gewesen sei, jedoch sei „das ganze Schema des Denkens“ zu bezweifeln, welches von einer „Vergleichbarkeit von Kriegshandlungen mit der planmäßigen Ausrottung ganzer Gruppen der Bevölkerung“ ausgehe (26). Auch im Falle des Pogroms von Oktober wird heute wieder eine ähnliche Tu-quoque-Argumentation herangezogen, wenn die Absicht eines Genozids – denn ja, für die Definition eines Genozids ist die Absicht von Bedeutung – durch Hamas ignoriert wird und die Reaktion darauf, die Kriegshandlungen Israels im Gazastreifen, stattdessen zum Genozid umgedeutet werden, wenn Zahlen dramatisiert werden und von Seiten Hamas tote Soldaten als tote Zivilisten ausgegeben werden etc. Die erst kürzliche teilweise Rücknahme der Zahlen bei den getöteten Frauen und Kindern im Gazakrieg vonseiten der UN spricht hier eine deutliche Sprache, wie verlässlich die Berichterstattung ist. Um die Hälfte weniger seien bisher tatsächlich identifiziert, was Zweifel an verbreiteten Behauptung, 72% der Todesopfer seien Frauen und Kinder, aufkommen lässt. Auf Seiten Nazi-Deutschlands gab es übrigens weitaus mehr zivile Opfer als auf Seite der Briten und Amerikaner. Wobei wir wieder bei jenen Zahlenspielereien wären, von denen Adorno uns doch gerade noch versucht hat abzubringen.
Für Adorno ist es wichtig die Juden als „wesentlich(e) Träger der Aufklärung“ (28) zu identifizieren. Das „antisemitische Potential“, sei ebenso nur mit einem Bekenntnis zur Aufklärung zu bekämpfen. Dem Vorwurf „Juden entzögen sich der harten körperlichen Arbeit“, solle man nicht mit Beispielen von Juden aus der Arbeiterklasse begegnen, sondern mit dem Hinweis darauf, dass „harte physische Arbeit heute eigentlich bereits überflüssig“ sei und „es etwas tief Verlogenes hat, einer bestimmten Gruppe Vorwürfe zu machen, daß sie nicht hart genug physisch arbeitet“, denn es sei „Menschenrecht, sich nicht physisch abzuquälen, sondern lieber sich geistig zu entfalten“. Die Argumentation der Verteidiger Israels, dass Juden in Israel „mit saurem Schweiß das Land fruchtbar machen“, entfiele dadurch einfach (29), denn diese sei „im Grunde nur der Reflex auf die furchtbare soziale Rückbildung, die den Juden durch den Antisemitismus aufgezwungen wurde“. Ebenso sei dem „Vorwurf des Vermittlertums der Juden“, welcher immer mit jenem der Verschlagenheit und der Unehrlichkeit einhergehe, zu begegnen. Denn eine „bürgerliche Tauschgesellschaft“ bedürfe eben einer solchen Vermittlerrolle (30): „Ohne die Sphäre des Vermittlertums, die von Handel, Geldkapital und Mobilität, wäre die Freiheit des Geistes, der sich von der bloßen Unmittelbarkeit gegebener Verhältnisse löst, unvorstellbar gewesen.“ (31)
Dass Adorno mit seiner Sorge um die Pädagogik und deren Einfluss auf die Ausbildung des antisemitischen Potentials Recht hatte, zeigt sich heute anhand der akademisch institutionalisierten Formen des Antisemitismus und des Antizionismus in der vermeintlich progressiven postmodernen Philosophie, die sich in den Sozialwissenschaften festgesetzt haben.
Detlev Claussen schreibt im Vorwort von Léon Poliakovs „Vom Antizionismus zum Antisemitismus“, dass die „antizionistische Selbststilisierung (…) ein Bedürfnis nach Weltanschauung“ dokumentiere „die von der Wirklichkeit in Geschichte und Gegenwart unabhängig macht“, die Flucht in ein manichäisches Weltbild, aus dem Wunsch heraus sich der „Auseinandersetzung mit einer widersprüchlichen Realität“ zu entziehen (Léon Poliakov: Vom Antizionismus zum Antisemitismus, S. 12). Lässig hüllt man sich an den Unis nun in die Kufiya, wobei man sich bei der Verwendung der roten oder schwarzen Variante dann nicht mehr ganz so sicher ist, und schminkt sich die Augenlider schwarz-rot-grün, während man aus Solidarität mit den „Freiheitskämpfern“ mit der AK-47 „We don’t want no two states, we want 48“, „Iran you make us proud“, „Burn Tel Aviv zu the ground“, „Long live the Intifada“, „Ya Hamas, we love you“ und „Jews, go back to Poland“ brüllt. Vergessen sind die Proteste im Iran 2022 unter dem Motto „Frau Leben Freiheit“, deren Protagonist*innen man im Nachhinein nur noch, im Einklang mit der Islamischen Republik Iran, als „kryptojüdische“ Agenten und Agenden zu identifizieren vermag.
Hat Adorno sich in seiner Rede explizit mit dem Antisemitismus der Rechten befasst, erkannte Jean Amérys Blick auf das Problem des Antisemitismus schon früh, dass nicht nur der Rechtsextremismus ein solches hatte, sondern dass die Linke – und er sah sich selbst als Teil davon – im Angesicht des Nahost-Konflikts zunehmend an der Aufgabe scheiterte zu den eigenen progressiven Werten zu stehen. Améry gab sich auch zeitlebens des Öfteren der Kritik der Dialektik der Dialektiker hin, wenn diese beispielsweise die Quäler mit den Gequälten beliebig gleichsetzte – denn schließlich war doch ein jeder irgendwann Opfer von irgendwem.
„Den dialektischen Denkern sitzt allerwegen die Furcht vor der Banalität im Nacken – etwa der Banalität, Opfer Opfer und Quäler Quäler sein zu lassen, wie sie es beide waren, als geschlachtet wurde.“ (Jean Amery: Jargon der Dialektik [1967], In: Werke, Bd. 6 Aufsätze zur Philosophie. S. 290)
Dass Améry dieser Angst vor der Einfachheit nicht zum Opfer fiel, seine Erkenntnisse aber dennoch nie banal blieben, zeigt sich in der Textsammlung „Der neue Antisemitismus“. Im einleitenden Essay „Mein Judentum“, 1978 plädiert Améry für den Begriff „Judesein“, da ihm die Identität des Juden von außen aufgezwungen wurde. Er wuchs als Hans Mayer im katholischen Oberösterreich auf, mit Weihnachtsmesse und „Jessasmariaundjosef“, als Sohn eines nichtgläubigen Juden, der im Ersten Weltkrieg starb und einer Christin, mit teils jüdischen Vorfahren. Erst nach dem Umzug nach Wien wird ihm in der Auseinandersetzung mit dem „intellektuellen“ Antisemitismus und der „Lektüre (…) nationalsozialistischer Schriften“ langsam „das Eigenbild vom Gegner“ aufgeprägt (25). Als er 1935 in einem Kaffeehaus das „Nürnberger Reichsbürgergesetz“ liest, wird ihm erstmals wirklich sein „Judesein“ klar (29). 1938 flüchtet er mit seiner ersten Frau Richtung Belgien, wo er andere Juden trifft, die ihm aber, trotz „Schicksalsgemeinschaft“, fremd sind. Er hat „zwar“ prinzipiell „(s)ein Judesein angenommen“, praktisch „versagt()“ er aber (31).
Dass er nicht nur in Deutschland zum „Juden gemacht“ wird, sondern „(d)ie Welt“ ihn „als einen solchen“ haben will, erkennt er auf der Flucht, was dazu führt, dass er sich zunehmend ein „Gefühl der Solidarität mit jedem Juden“ abringt (32). In Frankreich bricht er aus dem Internierungslager aus und unternimmt den „letzten Versuch“ sich „dem Judesein (…) zu entziehen“, indem er sich dem Widerstand anschließt und zunächst als Widerstandskämpfer festgenommen wird (33). Als den Nazis aber seine jüdische Herkunft klar wird, bekommt er ohne Prozess das Todesurteil: Auschwitz (34). Sein „Judesein“ wird hierin bestätigt, mit dem „Judentum“ hat er nichts zu tun (35).
Und dieser Blick, der sich aus seiner Erfahrung speist, ist es auch, der Amérys klare Positionierung zu Israel bestimmte:
„Das einzige, was mich positiv mit der Mehrzahl der Juden der Welt verbindet, ist eine Solidarität, die ich mir längst nicht mehr als Pflicht gebieten muss, und namentlich die mit dem Staat Israel. (…) Für mich ist Israel keine Verheißung, kein biblisch legitimierter Territorialanspruch, kein Heiliges Land, nur Sammelplatz von Überlebenden, ein Staatsgebilde, wo jeder einzelne Einwohner noch immer und auf lange Zeit hin um seine physische Existenz bangen muss. Mit Israel solidarisch sein heißt für mich, den toten Kameraden die Treue bewahren.“ (36-37)
„Der ehrbare Antisemitismus“ von 1969 befasst sich mit dem, was wir auch heute noch in der Auseinandersetzung mit dem sogenannten Antizionismus der Linken sehen, einer Aktualisierung des klassischen Antisemitismus, seiner Anpassung an gegenwärtige Entwicklungen: Man redet vom „israelische(n) Unterdrücker, der mit dem ehernen Tritt römischer Legionen friedliches palästinensisches Land zerstampft“. Der „Sozialismus der dummen Kerle“ stand also bereits 1969 „im Begriff, ein integrierender Bestandteil des Sozialismus schlechthin zu werden, und so macht jeder Sozialist sich selber freien Willens zum dummen Kerl“ (40). Wo heute der Diskurs aber fest in der Hand von Godwins Gesetz liegt und der Vergleich nicht vor einer Gleichsetzung der Israelis mit den Nationalsozialisten, oder zumindest mit dem Apartheidsregime Südafrikas, haltmacht, war 1969 von Vergleichen mit Vietnam und Algerien dominiert, bzw. vom Klassiker, der guten alten David-gegen-Goliath-Analogie (41). Was heute der „Terrorstaat Israel“ ist, war 1969 der „Verbrecherstaat Israel“, das heutige „kolonialistische Gebilde“ ist der „Brückenkopf des Imperialismus“ der 60er-Jahre (42). Auch das bekannte Argument, man betreibe „Meinungserpressung“ „mit sechs Millionen“ erwähnt Améry (45).
Améry lenkt ein, dass Israel zwar „objektiv die unerfreuliche Rolle der Besatzungsmacht“ trage, doch das „Bestehen dieses Staatswesens“ ihm „wichtiger“ sei „als das irgendeines anderen“ (43), sein „Bestand“ sei „unerlässlich für alle Juden“ (44).
Er geht hier auf die linke Doktrin der Solidarisierung mit den Schwächeren ein, anders als viele Linke sieht er aber die Araber als die Stärkeren, „an Zahl“, „an Öl“, „an Dollars“ und sogar „an Zukunftspotential“ (46). Die Linke versäume es, zu sehen „dass trotz Rothschild und einem wohlhabenden amerikanisch-jüdischen Mittelstand der Jude immer noch schlechter dran ist als Frantz Fanons Kolonialisierter, sieht das so wenig wie das Phänomen des anti-imperialistischen jüdischen Freiheitskampfes, der gegen England ausgefochten wurde.“ Auch sei es nicht „die Schuld der Israelis, wenn die Sowjetunion vergaß, was 1948 vor der UNO Gromyko (…) vorgetragen hat“, namentlich die offizielle Anerkennung des Staates Israel und die Befremdung über „die Einstellung der arabischen Staaten (…) militärische Maßnahmen zu ergreifen mit dem Ziele, die nationale Befreiungsbewegung der Juden zu vernichten“ (46-47).
Améry zitiert hier auch den damaligen Unterrichtsminister von Syrien: „Der Hass, den wir unseren Kindern einprägen, ist ein heiliger Hass“ (49). Dass sich dieser heilige Hass inzwischen institutionalisiert hat, liegt auch daran, dass dieser mit Hilfe von u. a. von der UNRWA publizierten und durch die EU finanzierten Schulbüchern verbreitet wird, und damit bereits Kinder mit Antisemitismus „geimpft“ werden – hier nicken wir wieder kurz Richtung Adorno – was wohl ein gewichtiger Grund für die heutige Misere ist.
Améry weist das Argument zurück, das auf einer Trennung von Antisemitismus und Antizionismus besteht: „Fest steht: der Antisemitismus, enthalten im Anti-Israelismus oder Anti-Zionismus wie das Gewitter in der Wolke, ist wiederum ehrbar.“ (42)
Améry lässt dazu den Philosophen Robert Misrahi zu Wort kommen: „Der Antizionismus ist ein von Grund auf reaktionäres Phänomen, das von den revolutionären progressistischen antikolonialistischen Phrasen über Israel verschleiert wird“ (49). Améry beschließt seinen Essay mit der Anklage „Die Allianz des antisemitischen Spießer-Stammtisches mit den Barrikaden ist wider die Natur, Sünde wider den Geist (…)“, einen „ehrbaren Antisemitismus“ gebe es nicht (50).
„Die Linke und der ‚Zionismus‘“ stammt von 1969 und beschäftigt sich mit dem, auch heute wieder stark spürbaren, „(E)nt-definieren“ des Begriffes „Zionismus“. Als „Zionisten“ werden auch hier bereits „fast alle Einwohner des Staates Israel, mit Ausnahme winziger Sekten, die, in diesem Staate und durch ihn lebend, das staatliche Gebilde Israel bekämpfen“, bezeichnet. Doch nicht nur das, auch Juden, welche in der Diaspora leben, und die für die Existenz Israels eintreten, würden unter dem Begriff summiert (51). Inzwischen werden unter dem Ausdruck überhaupt alle geführt, die für diese Existenz eintreten. Besonders nach dem 7. Oktober lebt die Tradition neu auf, die zur Unterteilung in „gute“ und „schlechte“ Juden führt, wobei es sich bei Zionisten um die „schlechten“ handelt.
Im Zusammenhang mit den Studentenbesetzungen an amerikanischen Universitäten wird periodisch die Trumpfkarte herausgezogen, wenn es heißt, diese seien maßgeblich von jüdischen Studierenden mitorganisiert worden. Als der ORF vor einigen Tagen über den „Protest“ eines Mannes gegen den Gazakrieg bei der Konferenz gegen Antisemitismus berichtete, bei dem dieser mehrere Liter Kunstblut verschüttete, wurden Kommentierende nicht müde darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Mann um einen Juden handelte. Zudem wird regelmäßig behauptet „viele Juden“ seien Anti-Zionisten – der nächste Name, der dann zumeist fällt, ist Norman Finkelstein – und selbst der ist nicht begeistert von der Verwendung des Slogans „From the river to the sea“, was man aber in der Protestbewegung geflissentlich ignoriert. Mit der Behauptung die Opfer vom 7. Oktober seien „nur“ Zionisten oder – noch schlimmer – IDF-Soldaten, wobei natürlich geflissentlich vergessen wird, dass die IDF ein Pflichtheer ist – und damit keine unschuldigen Zivilisten, kann man alle Gräueltaten relativieren.
Die Gleichsetzung von „Zionismus“ mit dem Nationalsozialismus stellt schon Améry fest, so nenne man ihn auch „National-Zionismus“. Er vermeint im Kampf gegen diesen „Zionismus“ den „Eifer“ der Jakobiner wiederzuerkennen, wenn Israel „als (…) Waffenträger westlicher, beziehungsweise amerikanischer imperialistischer Unterdrückung“ gezeichnet wird. Sarkastisch bemerkt er: „Unter Zionismus versteht die Linke ungefähr das, was man so vor rund dreißig Jahren in Deutschland als ‚Weltjudentum‘ genannt hat“. Das „Israel-Bild“ der Linken sei „gekennzeichnet durch die hässlichen Züge militaristischer, so nicht faschistischer Gewalttätigkeit“, was dann logischerweise dazu führe, dass man sich den „verschiedenen arabischen Freikorps“ – gemeint ist hier die Fatah – zuwende (52). Spiegelbildlich findet sich dies heute wieder in der Liebe zur rechtsextremen Hamas, deren zugrundeliegender Orientalismus (wenn Saids Theorie schon bedient werden muss) wohl kaum zu leugnen ist. Die „Widerstandskämpfer“ der Fatah wurden durch die noch extremere Hamas ersetzt.
Doch wenn bereits 1969 „die Nazi-Katastrophe tiefe Geschichte“ (53) war, wie will man heute erst die linke Bewegung zur Selbstreflexion bringen? Denn, davon ist Améry überzeugt: „Um das Phänomen Israel zu verstehen, muss man (…) vollumfänglich die jüdische Katastrophe begreifen. In Israel ist, metaphorisch gesprochen, jedermann Sohn, Enkel, eines Vergasten; in Deutschland und im übrigen Europa kann man es sich leisten, überhaupt nicht ‚Sohn‘, nicht ‚Enkel‘ zu sein.“ (54)
Dem Einwand, was die Palästinenser*innen denn dafür könnten, hält Améry entgegen, dass „die arabischen Flüchtlinge bei einigem guten Willen der arabischen Staaten in diesen Aufnahme hätten finden können, während vor den unter Hitler verfolgten und mit Mord bedrohten Juden alle Türen zufielen“ (55). Dem Argument, das so gerne vorgebracht wird, bei Israel handle es sich um ein ganz und gar unnatürliches Staatengebilde, ganz im Gegenteil zu den anderen hunderten ganz und gar natürlichen Staatengebilden, begegnet Améry mit einem lapidaren Hinweis darauf, dass der Staat Israel nun einmal existiere und „nicht mit weniger völkerrechtlicher Legitimation geschaffen“ wurde „als irgendein anderer“ (55).
Als „Besatzer“ könne Israel sich aber natürlich nicht „dem Mechanismus von Gewalt und Gegengewalt“ entziehen. Die Frage, welche Wahl Israel aufgrund seiner historischen Lage habe, wolle man sich aber in der Linken nicht stellen: „Ein für allemal haben sich für die in erschreckender Vereinfachung die Fronten gebildet: hie der israelische Unterdrücker, da der arabische Freiheitskämpfer!“ (56)
Der alte Antisemitismus findet da auch ein „zudem noch als Alibi geltendes Ventil durch den Antizionismus der Junglinken“; es seien die Juden „welche da als Unterdrücker stigmatisiert werden“, die schließlich „immer schon den Popanz des Weltfeindes abgeben mussten“ (59). Améry warnt mit dem „Antizionismus“ reiche man „dem Antisemitismus jenen kleinen Finger (…) dem unweigerlich die ganze Hand nachfolgen“ müsse (61), und zusätzlich laufe man Gefahr die Juden weltweit „ins reaktionäre Lager“ abzudrängen (60). Ebendies ist inzwischen Realität, aber vielleicht nicht auf die Weise, wie Améry es gemeint hat – schließlich sind in der westlichen Welt Jüdinnen und Juden in progressiven und linken Bewegungen bis heute in beträchtlicher Anzahl vertreten und wählen auch oft linke Parteien – sondern insofern als sie als Zionisten automatisch als Reaktionäre kategorisiert werden. Was die Politik in Israel betrifft, so setzt sich der Großteil der israelischen Bevölkerung inzwischen aus Mizrachim – Juden aus dem Nahen Osten – zusammen, die tendenziell eher Parteien rechts der Mitte wählen und hier auch aktiv in der Politik vertreten sind (siehe: Ben-Gvir), während die von der Linken so verteufelten Ashkenazim (Stichwort: „Go back to Poland!“) eher linke Parteien bevorzugen.
In „Juden, Linke – Linke Juden“ von 1973 kritisiert Améry bereits die Verklärung von Terroranschlägen zur „Gegengewalt“, mit der man versuche „jede Art von Grausamkeit zu rechtfertigen“ (65). Auch hier fühlt man sich an die Wortmeldungen nach dem 7. Oktober und – vielfach – seither erinnert. An die Rechtfertigung der Vergewaltigungen und die Brutalität gegen Kinder, die man dann im Slogan „Kindermörder Israel“, der sich obendrauf der uralten Ritualmordlegende bedient, nur dem israelischen Militär vorwirft. Eine weitere Entwicklung, die Améry bereits feststellte, ist die Tendenz das „Wort eines Juden“ nicht zu akzeptieren, wenn dieser sich proisraelisch äußert, und nur noch das Wort jener Juden gelten zu lassen, das dem linken Selbstverständnis nicht entgegensteht. Diese Meinung sieht Améry aber nicht als repräsentativ für einen Großteil der Juden weltweit. Dennoch ist es Améry wichtig zu betonen, dass diese Bindung an den Staat Israel nicht bedeute, man stimme allem widerspruchslos zu, was in der israelischen Politik passiert (66). Heute spiegelt sich die Tendenz das Wort des „schlechten“ Juden nicht zu akzeptieren, auch in der Tendenz wider, jede pro-israelische Aussage mit der Frage zu beantworten, ob derjenige, der sich so äußert, vielleicht selbst Jude oder zumindest Kryptojude sei.
Dies erinnert stark an das, was Léon Poliakovs Essay von 1969 bereits thematisierte. Er befasste sich mit der „Entstehung“ des Begriffs Antizionismus – wie er heute gern gebraucht wird – in Russland, wobei er auf die Russische Revolution eingeht, die Rolle jüdischer Revolutionäre, sowie Antisemitismus und Verfolgung zur Zeit der Sowjetunion, die in Schauprozessen in den 1950ern mündeten, die sich nur vordergründig gegen „Zionisten“, in Wahrheit aber gegen Juden richteten. Anstatt sie in den Akten als Juden zu kennzeichnen, nannte man sie Zionisten. Den Angeklagten wurde zumeist Verschwörung, Verrat und „zionistische“ Spionage vorgeworfen. Die sowjetische Zeitung „Krasnaja Swesda“ schrieb am 20. Februar 1953 „(d)er Kampf gegen den Zionismus (…) habe mit Antisemitismus nicht das Geringste zu tun“ (Poliakov, 68). Auch hier zeigte sich, wer Jude war, musste Zionist sein und wer Zionist war, war höchstwahrscheinlich auch Jude (Poliakov, 66).
In „Der neue Antisemitismus“ von 1976 fragt Améry „Was sagt der neue Antisemit? (…) Er sei nicht der, als den man ihn hinstelle, nicht Antisemit also sei er, sondern Anti-Zionist!“ (75) So ist es 1976 bereits gang und gebe „Schlagt die Zionisten tot, macht den Nahen Osten rot!“ zu rufen, zweifelsfrei ohne den eigenen Antifaschismus je hinterfragen zu müssen, bzw. ohne sich an „das ganz eindeutige ‚Juda verrecke‘ der Nazis“ erinnert zu fühlen (76). Antizionismus sei also „die Aktualisierung des uralten, offensichtlich unausrottbaren, ganz und gar irrationalen Judenhasses von eh und je“ (77). Der Wille des Antisemiten sei es, im Juden, egal was dieser tue, als „das radikal Böse“ zu sehen (79). In seiner Rede „Der ehrbare Antisemitismus“ zur Woche der Brüderlichkeit 1976 bemerkt Améry die Rolle der UdSSR für die Meinungsbildung der Linken, für die Israel „ein imperialistisches Krebsgeschwür“ sei und „die Juden im Allgemeinen Komplizen des kapitalistischen Komplotts in Permanenz“ (86).
Im Gegensatz zu den Behauptungen der Antizionisten, sei die „Funktion“, die Israel im jüdischen Bewusstsein einnehme, Améry zufolge, eine psychologische: „Seit es Israel gibt, weiß er, der Jude ist nicht, wie der Antisemit es ihm so lange eingeredet hatte, bis es zur Überredung schließlich gekommen war, feige, unfähig zu manueller Arbeit, geboren nur zu Geldgeschäften, untauglich zum Landbau, ein faselnder Stubenhocker und bestenfalls geistreichelnder Schwätzer. Er weiß aber noch mehr: Nämlich, dass, wenn immer es ihm, wo immer, an den Kragen ginge, ein Fleck Erde da ist, der ihn aufnähme, unter allen Umständen. Er weiß, dass er solange Israel besteht, nicht noch einmal unter schweigsamer Zustimmung der ungastlichen Wirtsvölker, günstigenfalls unteren deren unverbindlichem Bedauern, in den Feuerofen gesteckt werden kann.“ (Améry, 68)
Dass es dabei als „einzigen Alliierten“ die USA an seiner Seite habe, sei der Tatsache geschuldet, dass es eben nicht besonders viel Auswahl gebe: „Es hat die einzige Hand ergriffen, die sich ihm hilfreich entgegenstreckte.“ (70)
„Müssten nicht eben sie [Anm.: die Linken], die mehrheitlich akademisch gebildet sind und auch einige Geschichtskenntnis haben, verstehen, dass prinzipiell die Lösung der palästinensischen Frage nur eine technische ist, während der von soviel Hass umbrandete Judenstaat, wenn er unterginge, seinen Bewohnern als Erbstück nichts hinterlassen würde als das Schlachtmesser des bereits zum Mord erzogenen Gegners?“ (82), fragt er.
Améry ist der Überzeugung, dass die Linke dies insgeheim wisse, es aber verdränge, und diese Indifferenz sei es, welche schließlich den Kreis schließe zum „Spießer-Antisemitismus“. Die größere Gefahr gehe inzwischen von diesem linken Antisemitismus aus, der aus einer Mischung aus Ignoranz, aber auch „antisemitischer Tradition“ schöpfe und „mit historisch-moralischem Pathos“ auftrete (82-83).
Auch die typische Argumentation, dass man ja nichts gegen Juden habe, sondern ein Problem mit Israel, wird hier wieder klar. Dagegen bringt Améry seinen Namensverwandten Hans Mayer ins Feld, der schrieb „Wer den Zionismus angreift, aber beileibe nichts gegen die Juden sagen möchte, macht sich oder anderen etwas vor. Der Staat Israel ist ein Judenstaat. Wer ihn zerstören möchte, erklärtermaßen oder durch eine Politik, die nichts anderes bewirken kann als solche Vernichtung, betreibt den Judenhass von einst und von jeher. Wie sehr das auch am Wechselspiel von Außenpolitik und Innenpolitik beobachtet werden kann, zeigt die Innenpolitik der derzeitigen anti-zionistischen Staaten: Sie wird ihre jüdischen Bürger im Innern virtuell als ‚Zionisten‘ verstehen und entsprechend traktieren.“ (87)
Und so komme es in der Auseinandersetzung mit dem Nahost-Konflikt zu einer Solidarisierung der Linken mit dem „dummen Antisemitismus“ und dem Antisemitismus der Bourgeoisie, die „atmet erleichtert auf, dass sie hier für einmal im Gleichschritt marschieren kann mit der ansonsten von ihr als Ärgernis angesehenen jungen Generation“, Menschen, die selbst „oftmals noch keinen Juden von Angesicht zu Angesicht sahen“, „(u)nd es ist ihnen wohl beim Gedanken, dass ausnahmsweise auch sie sich in Richtung des objektiven Geistes bewegen“. Der Antisemitismus sei in diesem Zusammenschluss „ehrbar“ geworden (89).
Améry stellt das „Recht“ der Palästinenser*innen klar, die sich zu jener Zeit noch „in der Phase der Nationwerdung“ befanden, die es bis dahin „als Nation nicht gab“ (93). Jene, die innerhalb Israels lebten, hätten das Recht gleiche Bürgerrechte auszuüben, jedoch auch eine Pflicht auf Loyalität mit dem Staat. Jene, die außerhalb lebten, sollten jedoch endlich anerkennen, dass Israel als Staat existiere und dass es sich beim Zionismus um eine „nationale Befreiungsbewegung“ handle (94).
Schon 1976 schreibt Améry über das gängige Argument, dass die Juden im Islam „stets friedlich“ mit den Muslimen gelebt hätten und verweist auf die Dokumentation Albert Memmis, eines tunesisch-jüdischen Schriftstellers, die dieser Argumentation bereits damals widersprach. Antisemitismus sei auch hier Alltag gewesen, Juden hätten stets als „Bürger zweiter Klasse“ gelebt und dies gelte auch für die wenigen, die immer noch in arabischen Ländern lebten (98-99). Pessimistisch stellt er fest, heute werde „(a)us der Nahost-Frage (…) im Nu eine neue Judenfrage“ und wie diese gern beantwortet werde, „das wissen wir aus der Geschichte“. Das „ebenso vorsichtige wie deutliche Abrücken von Israel“ (101) sehen wir gegenwärtig wieder deutlich.
Améry geht zudem auf die UN-Resolution von 1975 ein, die mit Hilfe der UdSSR und einiger arabischer Staaten adaptiert wurde, nach der Zionismus fortan als Form von Rassismus und rassistischer Diskriminierung zu gelten habe. Er erwähnt nun Simone de Beauvoir und Jean Paul Sartre, die er sarkastisch als „weitum als Knechte des Imperialismus bekannte Persönlichkeiten“ bezeichnet, als Beispiel für jene kleine Gruppe von Linken, die gegen diese Resolution protestierten, die aber im Endeffekt keinerlei Macht hatte (95). „Wo Macht ist, vom Weißen Haus in Washington bis zum Palais d’Elysée, von Downing Street bis zum Kreml, wo man längst verdrängt hat, dass es mehrheitlich Juden waren, die das Vaterland aller Werktätigen aus dem Boden des alten Russland stampften, ist man, diplomatisch mehr oder weniger paraphrasierend, bereit, das ‚Recht der Araber‘, das sich in Petro-Dollars quantifizieren lässt, zu verteidigen und das Recht der Juden, welches das ewige Unrecht der Armen ist, für ein paar Silberlinge zu verkaufen.“(95)
„Öffentliche Meinung“, so Améry, setze sich aus „Meinungen über Meinungen“ zusammen. Er stellt hier eine maßgebliche Änderung in der öffentlichen Wahrnehmung Israels fest und hebt dabei auch die Rolle des Vatikans hervor, was die Bereitschaft anging, diese UN-Resolution zu unterstützen. So sprach der Papst vom „islamischen Charakter Jerusalems“ und einer notwendigen Vermeidung der „Judaisierung der Stadt“ (96), wohlwissend, dass Ostjerusalem erst 1948 von Jordanien besetzt worden war, wobei man das jüdische Viertel zerstörte – in der Altstadt von Jerusalem wurden 35 Synagogen demoliert und der Friedhof verwüstet, wobei Jordanien anschließend die Grabsteine für den Straßen- und Latrinenbau verwendete. Im Sechstagekrieg 1967 wurde Ostjerusalem wieder von Israel erobert.
Améry kommt im Laufe seiner Essays immer wieder auf die Rolle zu sprechen, die Israel für alle Juden der Welt spiele – auch für jene, die sich selbst als Antizionisten bezeichnen. So sei dieser „ein Gemeinwesen, das die Juden gelehrt hat, sich ihr Eigenbild nicht von Antisemiten aufprägen zu lassen“ (80). Für Améry ist dabei die „Virtualität (…) entscheidend“ (92). Seit es diesen Staat gebe, „haben die Juden für alle Fälle ein virtuelles Asyl“. Israel bedeutete endlich jüdische Souveränität. Juden waren nicht mehr dem Gutdünken der „Wirtsvölker“ ausgeliefert, die sich jederzeit entscheiden konnten, diese zu vertreiben, ihnen Besitz und Vermögen abzunehmen, sie zu ermorden, zu unterwerfen und des Landes zu verweisen. Ihr Schicksal lag nun vielmehr in ihrer eigenen Hand und hing von ihrem Sieg ab (81). Die Bindung an Israel habe nichts mit „Blut- und Rassemythen“ gemeinsam, sondern die Existenz Israels habe „alle Juden der Welt den aufrechten Gang wieder gelehrt“ (91).
Nach einer Reise nach Israel sieht sich Améry in seiner Position bestätigt, die Reise habe ihm aber „die allerletzten Illusionen genommen, dass ebendiese Position auch nur die geringste Chance hat, die Öffentlichkeit zu überzeugen“ (117).
Diese Desillusion zieht sich schließlich weiter durch seinen Text von 1977 „Grenzen der Solidarität“. Berichte über Folterungen in israelischen Gefängnissen schockieren ihn, doch das führt nicht dazu, dass er sich gegen Israel stellt, auch wenn er „in der Haut eines jeden Gefolterten (…) stecke“. Der Moral sei stets der Vorrang zu geben. Er warnt zudem davor, „rabbinische Gesetze zur Grundlage einer sozialen Gemeinschaft“ zu machen und damit die Legitimität des Staates von „Legenden“ abhängig zu machen (122-123).
Er appelliert an die Humanität der Israelis, selbst im Angesicht der Mordlust der Nachbarn, auch in Anbetracht der Diaspora, denn was in Israel passiere, werde auf alle Juden projiziert (125). „Bringt es nicht dahin, dass die unaufkündbare Solidarität, die uns an euch bindet, zur Katastrophengemeinschaft miteinander Untergehender werde.“ (125)
Améry ist überzeugt, sollte Israel zerstört werden und Israelis in der Folge gezwungen sein des Landes flüchten, werde auch die Linke endgültig zerstört, welche im Falle von Despotien der Welt, die nicht westlich seien, stets schweige. Dieser Konflikt sei eine Möglichkeit für die Bewegung sich die Frage zu stellen, ob sie noch für „humanistische() Werte“, Demokratie und Gerechtigkeit eintrete (106-107), ob sie also noch ein „Kind der Aufklärung“ (111) sei. Das „politische Hexeneinmaleins“ aber, sei die „totale Verwirrung der Begriffe, der definitive Verlust moralisch-politischer Maßstäbe“ (107).
Während Juden in den 30-er Jahren „empfohlen“ wurde nach Palästina auszuwandern, wird ihnen heute „empfohlen“ nach Polen – und damit zwischen den Zeilen in die Gaskammern – zurückzukehren, und wiederholt damit die revisionistische Behauptung, nach der Israel nur aus europäischen („weißen“) Juden, Kolonialisten und Siedlern bestehe. Wenn es sich bei Israel aber um ein kolonialistisches Projekt handelt, wo liegt dann das Zentrum des jüdischen Staates, in das die Zionisten heute zurückkehren sollen? Im Falle von Polen ist die Forderung doppelt hinterfotzig, hatte man sich seiner jüdischen Bevölkerung doch zwischen 1968 und 1972 ein zweites Mal – diesmal unter Federführung der Kommunisten – entledigt, als man ihnen zurief „Zionisten zurück nach Zion!“, sie zu Staatsfeinden erklärte und ihnen die Pässe abnahm.
Wenn das der Antizionismus ist, der sich so stolz und klar vom Antisemitismus abheben soll, warum klingt er dann so altbacken, als komme er mit der Zeitmaschine geradewegs aus dem Jahr 1894 angerattert, frisch wie die Patina auf der wiederbelebten Dolchstoßlegende? Doch nicht jeder Antizionist ist ein Antisemit, wie nicht jeder Holocaustleugner ein Holocaustleugner ist. Der Vorwand ist eben doch die harte Währung des Antisemitismus, demnach man die Juden präventiv schon für die Gründung Israels in die Gaskammern geschickt habe und ganz bestimmt in Zukunft weiterhin schicken werde, bis Palästina endlich frei sei.
Wer aber „die Existenzberechtigung Israels in Frage stellt, der ist entweder zu dumm, um einzusehen, dass er bei der Veranstaltung eines Über-Auschwitz mitwirkt, oder er steuert bewusst auf dieses Über-Auschwitz hin.“ (71)